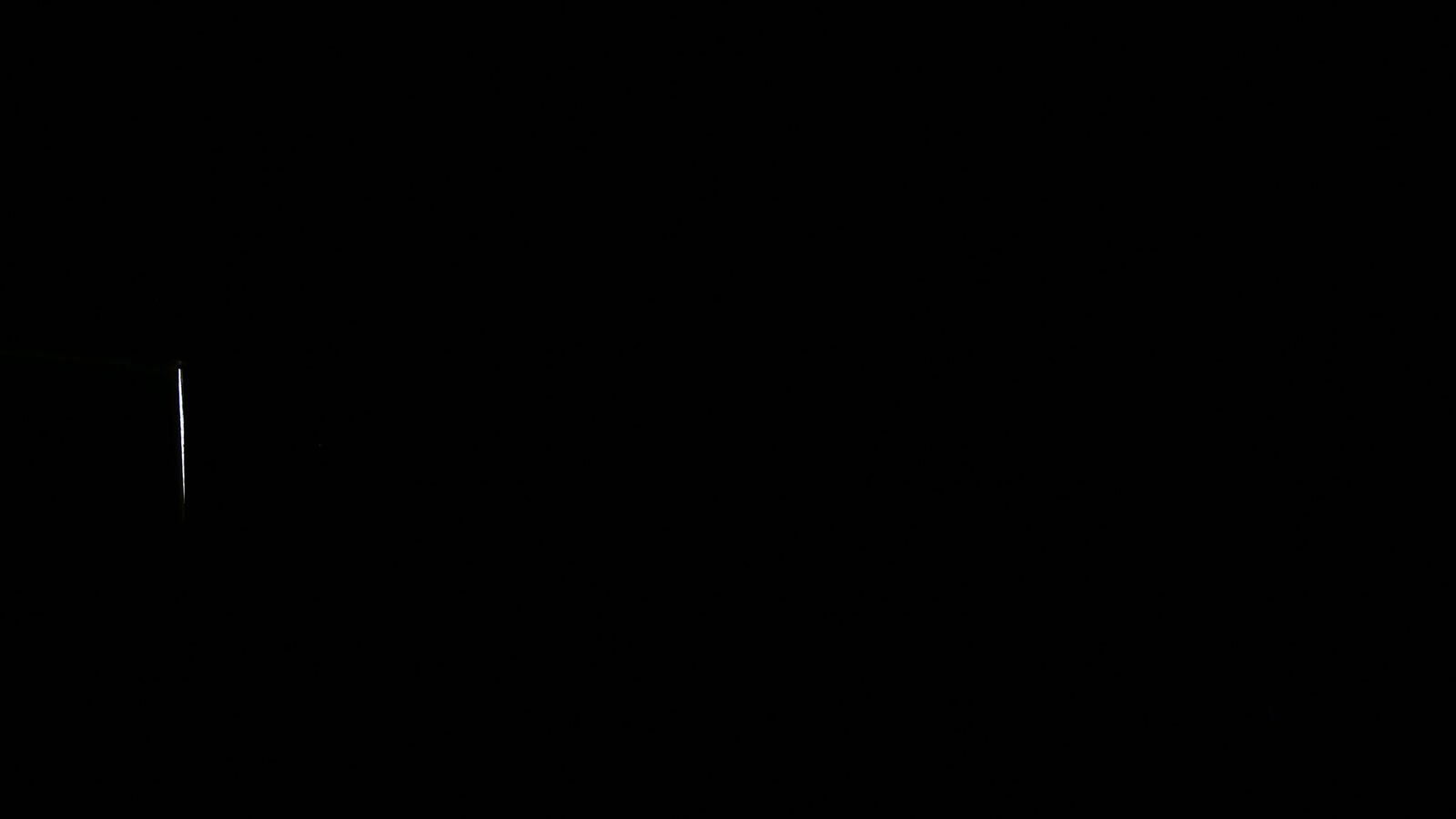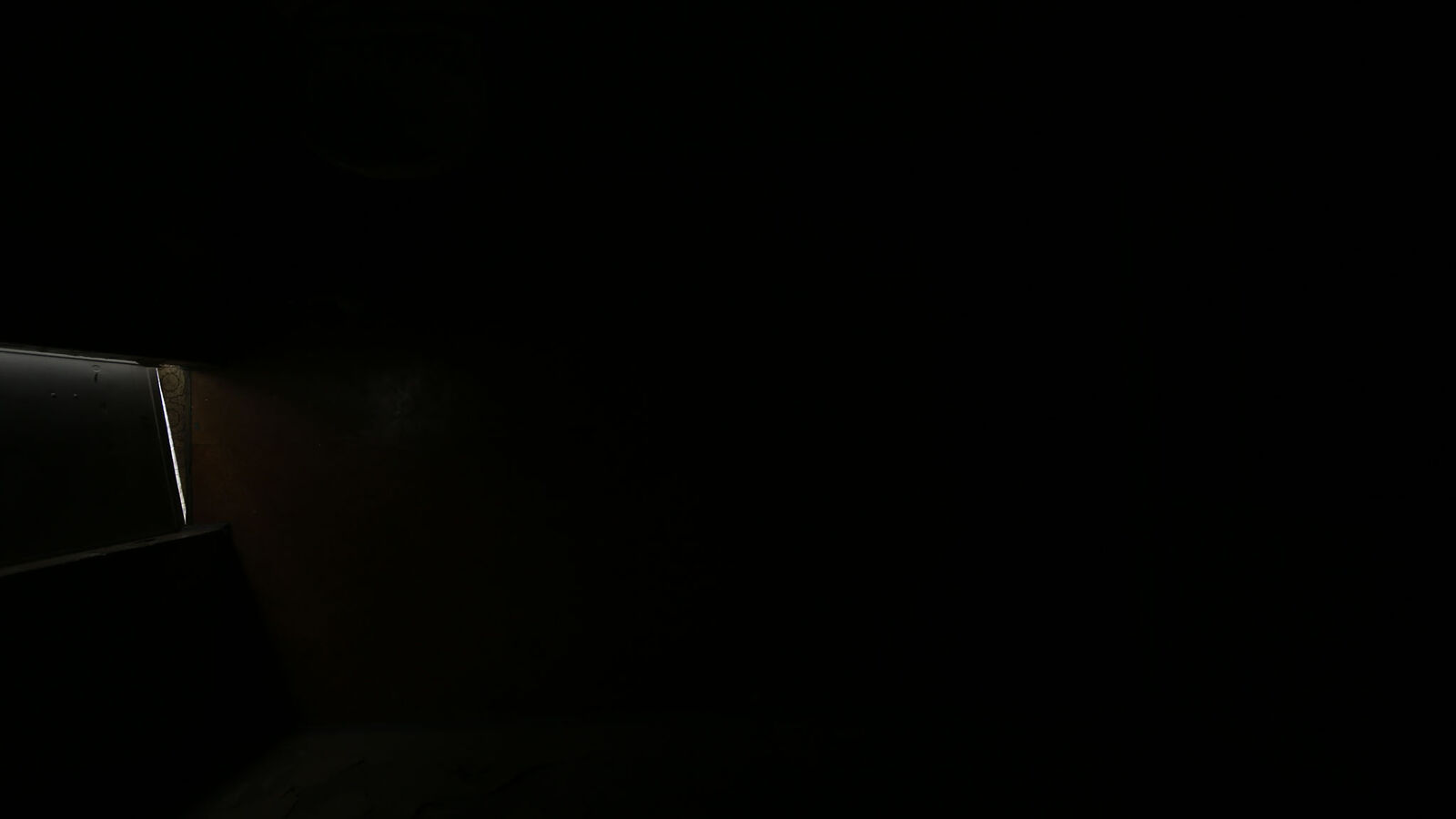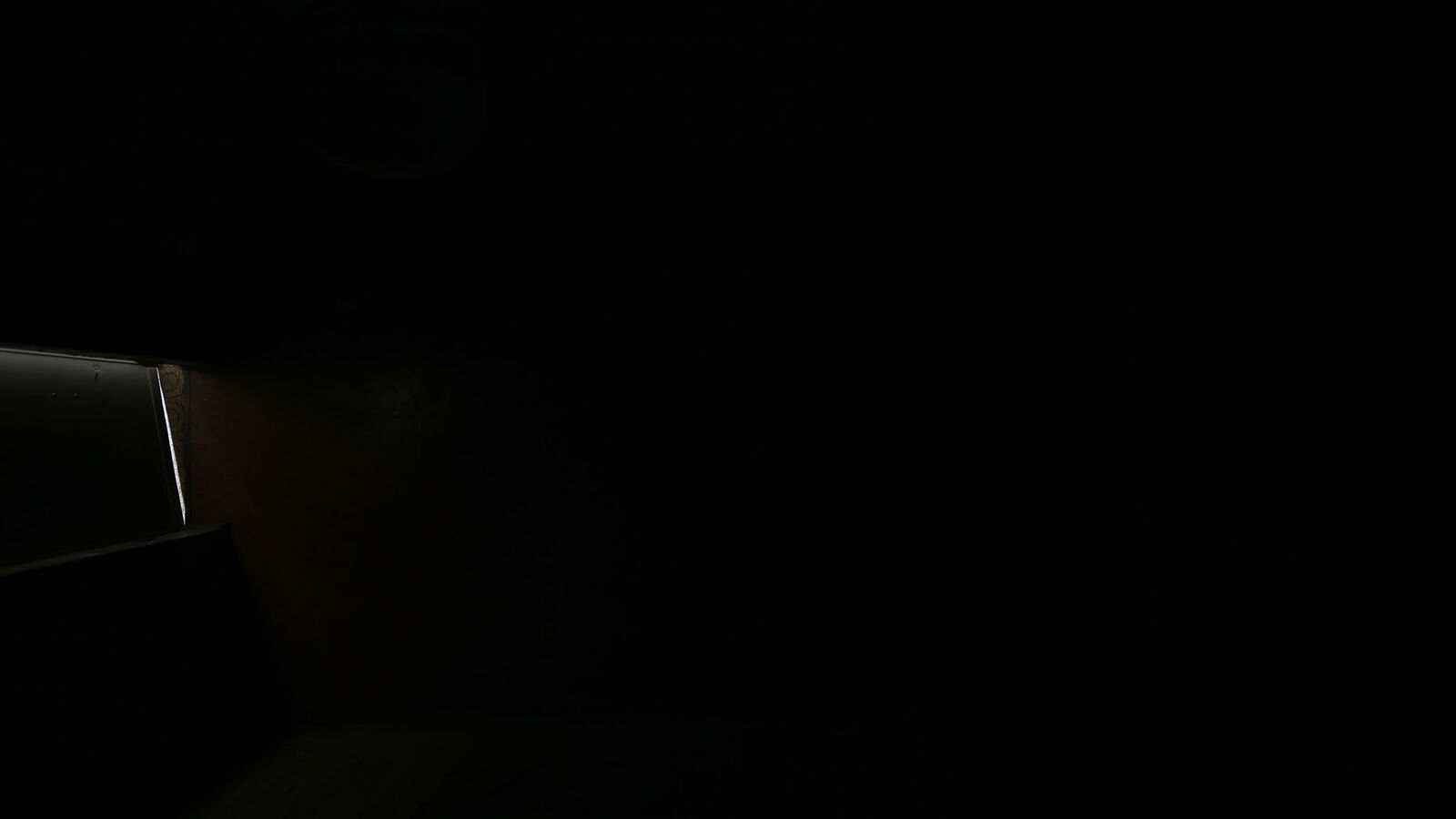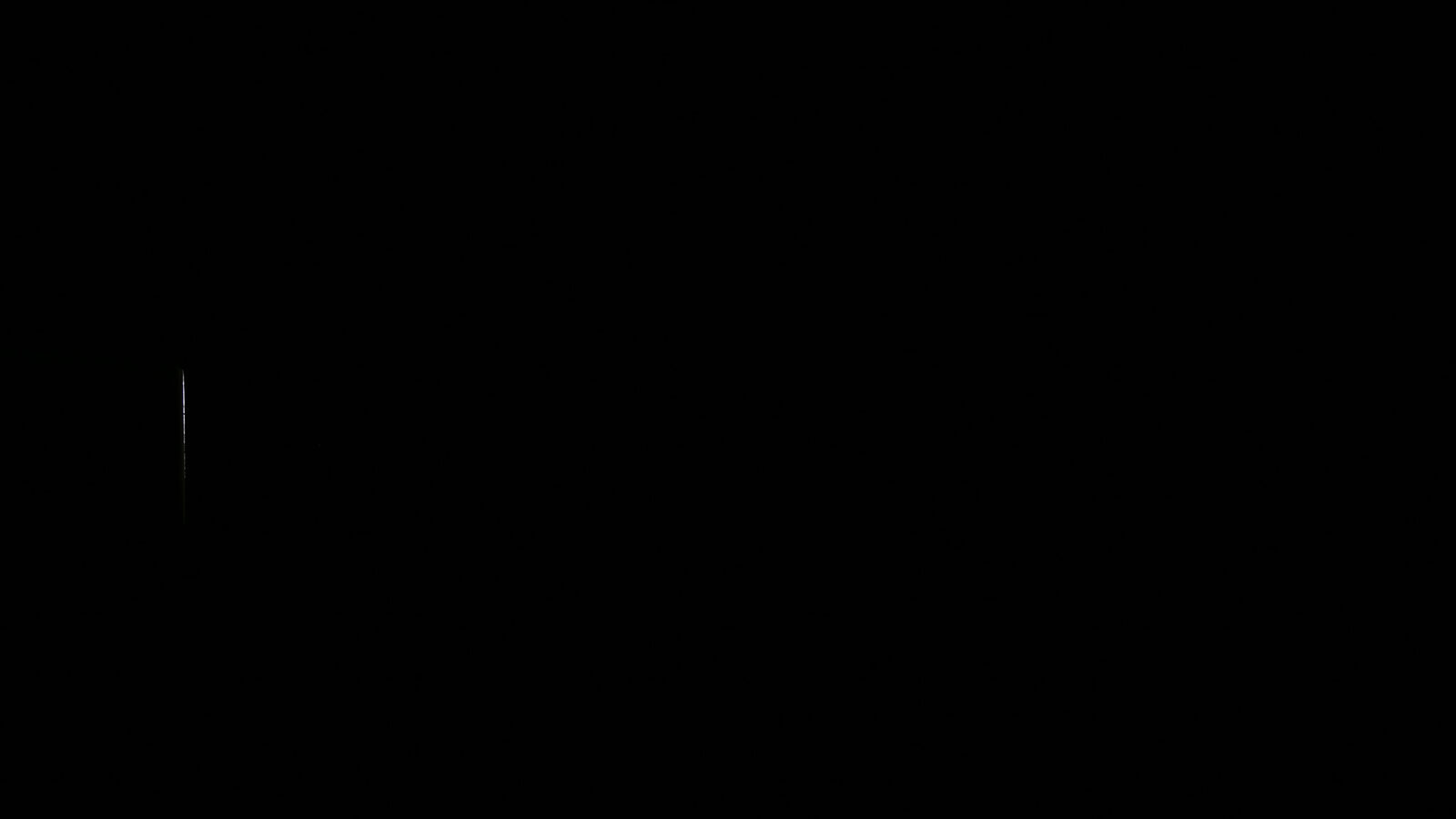, Vergangenheit, , 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, Gesetze, , , Präambel, Abschnitt Ⅰ, Kapitel 1, Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kapitel 2, Artikel 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Abschnnitt Ⅱ, Kapitel 1, Artikel 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Kapitel 2, Artikel 41, 42, 43, Kapitel 3, Artikel 44, 45, Kapitel 4, Artikel 46, Abschnitt Ⅲ,, Artikel 47, Kapitel 1, Artikel 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Kapitel 2, Artikel 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Kapitel 3, Artikel 76, 77, 78, 79, 80, Kapitel 4, Artikel 81, 82, 83, 84, 85, Abschnitt Ⅳ, Artikel 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, Abschnitt Ⅴ, Artikel 105, 106, Ende, Zeit, Namen, Einheitspartei, Parteitage, Ideologie, , Begriffe, Berlin-Lichtenberg, UHA, Bezirksverwaltungen, Berlin, , Cottbus, , Dresden, , Erfurt, , Frankfurt (Oder), , Gera, , Halle, , Karl-Marx-Stadt, , Leipzig, , Magdeburg, , Neubrandenburg, , Potsdam, , Rostock, , Schwerin, , Suhl, , Kreisdienststellen, Diensteinheiten, Juristische Hochschule, Ⅷ, Ⅸ, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, AG L, SR S, SR BMS, SR SK, AKG, ⅩⅠⅤ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AKG, ⅩⅩ, Unterlagen, Berlin-Hohenschönhausen, Untersuchungshaftanstalt, Gedenkstätte, , Nordflügel, Fahrzeugschleuse, Treppenhaus, Kellergeschoss, 0, 1, 2, 3, Erdgeschoss, 1001, 1024, 11, 12, 12a, 13, 101, 102, 104, 105, 106, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, Ostflügel, Erdgeschoss, 13a, 13b, 14, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 161, 162, 1010, 1014, 1015, 1016, Südflügel, Erdgeschoss, 157b, 166a, 15, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
Artikel 19 des Kapitels 1 des Abschnitts Ⅱ der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
(1) Die Deutsche Demokratische Republik garantiert allen Bürgern die Ausübung ihrer Rechte und ihre Mitwirkung an der Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie gewährleistet die sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit.
(2) Achtung und Schutz der Würde und Freiheit der Persönlichkeit sind Gebot für alle staatlichen Organe, alle gesellschaftlichen Kräfte und jeden einzelnen Bürger.
(3) Frei von Ausbeutung, Unterdrückung und wirtschaftlicher Abhängigkeit hat jeder Bürger gleiche Rechte und vielfältige Möglichkeiten, seine Fähigkeiten in vollem Umfange zu entwickeln und seine Kräfte aus freiem Entschluß zum Wohle der Gesellschaft und zu seinem eigenen Nutzen in der sozialistischen Gemeinschaft ungehindert zu entfalten. So verwirklicht er Freiheit und Würde seiner Persönlichkeit. Die Beziehungen der Bürger werden durch gegenseitige Achtung und Hilfe, durch die Grundsätze sozialistischer Moral geprägt.
(4) Die Bedingungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik werden durch Gesetz bestimmt.
I. Von den Grundrechten der Verfassung von 1949 zu den sozialistischen Grundrechten der Verfassung von 1968/1974
1. Die Grundrechte in der Verfassung von 1949
1 Die Verfassung von 1949 formulierte in den Art. 6-18 die klassischen Grundrechte ähnlich wie die Weimarer Reichsverfassung und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Sie enthielt außerdem soziale Grundrechte.
Die Rechte der Bürger waren in dem Abschnitt der Verfassung von 1949 enthalten, der die Überschrift »Inhalt und Grenzen der Staatsgewalt« trug. Schon das ließ den Schluß zu, daß mit ihnen dem Individuum eine Sphäre zuerkannt werden sollte, in der es, ohne Störungen durch den Staat ausgesetzt zu sein, leben und wirken konnte. Bestärkt wird diese Auffassung durch die Äußerungen Otto Grotewohls, des späteren ersten Ministerpräsidenten der DDR, auf der 5. Sitzung des Deutschen Volksrats am 22.10.1948 (Im Kampf um die einige deutsche demokratische Republik, Band 1, S. 272): »Die Staatsgewalt hat die persönlichen Freiheitsrechte des Bürgers zu respektieren und zu garantieren: die Gleichberechtigung vor dem Gesetz, die persönliche Freiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Versammlungsrecht, das Recht, Gesellschaften und politische Parteien zu bilden.« Wenn derselbe im Jahre 1947 geschrieben hatte (Deutsche Verfassungspläne, S. 88/89), eine Demokratie könne nur bestehen, wenn sie die Feinde der Demokratie vernichte, darum sollten Faschismus und Militarismus, Monopole und Großgrundbesitz keine »Opposition« bilden, die nach gewissen verfassungsrechtlichen Spielregeln ihr dunkles Spiel treiben dürften, diese stünden außerhalb der Verfassung und außerhalb der Gesetze, sie würden durch die Strafgewalt des Staates unterdrückt, es dürfe keine Grundrechte für sie geben, die diese Grundrechte selbst zu vernichten trachteten, die die politischen, gesellschaftlichen und staatlichen Fundamente untergrüben, so spricht diese Äußerung zwar für eine »wehrhafte« Demokratie, bei der freilich der Kreis der potentiellen Gegner bereits nicht unbedenklich weit gezogen und nur sehr unbestimmt beschrieben war, aber entgegen der Meinung von Eberhard Poppe (Die Rolle der Arbeiterklasse ..., S. 7/8) nicht für eine Konzeption, die die klassischen Grundrechte nicht als Freiheitsrechte gegenüber dem Staat ansieht. Das Bekenntnis zu einer wehrhaften Demokratie ist auch im Grundgesetz der Bundesrepublik zu finden (Art. 20 Abs. 4, Art. 21 Abs. 2), allerdings in anderer, wesentlich präziserer Formulierung. Auch eine noch frühere Äußerung Otto Grotewohls aus dem Jahre 1946, die im Verfassungsentwurf der SED formuherten Grundrechte seien »die fundamentalen Prinzipien der zukünftigen deutschen Staatspolitik« (Im Kampf um die einige deutsche demokratische Republik, Band 1, S. 83), kann nicht dafür ins Feld geführt werden, die Grundrechte der Verfassung von 1949 seien nicht als Freiheitsrechte konzipiert gewesen. Selbst Gerhard Haney räumte das im Jahre 1962 mittelbar ein, als er schrieb, der »bisherigen« Verfassung habe »die in Wirklichkeit bereits überwundene alte Vorstellung der Beziehungen von Staat und Bürger« zugrunde gelegen (Sozialistisches Recht und Persönlichkeit, S. 187). Auch Hermann Klenner trug dem wenigstens annähernd Rechnung, als er im Jahre 1964 schrieb, die geltende Verfassung habe mit ihrer Grundrechtsdarstellung als »Inhalt und Grenzen der Staatsgewalt« den Dualismus nur zum Teil überwunden (Studien über die Grundrechte, S. 90).
2. Die Verwandlung in sozialistische Persönlichkeitsrechte
2 Lange Zeit hindurch wurde die Grundrechtsproblematik von der rechtswissenschaftlichen Literatur der DDR vernachlässigt. Im Jahre 1957 meinte Ulrich Krüger, die Arbeiter-und-Bauern-Macht habe sowohl die bekannten und überkommenen Freiheitsrechte umgewandelt, als auch die wichtigsten Gestaltungsrechte zusätzlich festgelegt, die über die in den Verfassungen bürgerlicher Staaten fixierten Grundrechtskataloge hinausgingen (Sozialistische Masseninitiative und Grundrechte, S. 185). Auf dem V. Parteitag der SED setzte sodann Walter Ulbricht am 10.7.1958 ein neues Zeichen. Er verkündete, die in der Verfassung niedergelegten Grundrechte hätten »im Leben« eine Weiterentwicklung erfahren. Sie hätten sich in »sozialistische Persönlichkeitsrechte« verwandelt (Über die Dialektik unseres sozialistischen Aufbaus, S. 148).
Mit der Wendung über die »Weiterentwicklung im Leben« charakterisierte er aus seiner Sicht die Diskrepanz zwischen der Formulierung der Grundrechte in der Verfassung von 1949 und der Verfassungswirklichkeit, die durch die »antifaschistisch-demokratische« und die »sozialistische Umwälzung« (Präambel der Verfassung von 1968) bestimmt war und in der die Grundrechte niemals als Freiheitsrechte respektiert wurden (dazu die zahlreichen Dokumente in der mehrbändigen Sammlung »Unrecht als System«, ferner Dietrich Müller-Römer, Die Grundrechte in Mitteldeutschland, S. 107 ff.). Insbesondere der Grundrechtsteil der Verfassung von 1949 wurde nunmehr im Rückblick, der auch auf die Zeit seit 1946/1947 (Schaffung der Länderverfassungen, die bis auf die Verfassung des Landes Brandenburg einen umfangreichen Grundrechtsteil hatten - Siegfried Mampel, Die Entwicklung der Verfassungsordnung in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands von 1945 bis 1963, S. 505) erstreckt wurde, im Sinne der marxistisch-leninistischen Staats- und Rechtstheorie interpretiert (s. Rz. 41 zur Präambel). Als besonders markantes Beispiel seien Sätze von Eberhard Poppe (Die Rolle der Arbeiterklasse ..., S. 7) zitiert: »Die 1946 von der Arbeiterklasse vorgeschlagenen und auch in die Länderverfassungen und 1949 in die Verfassung der DDR aufgenommenen Rechte waren antifaschistisch-demokratische Rechte des Bürgers. Ihre revolutionäre Verwirklichung unter Führung und Anleitung der Arbeiterklasse durch alle fortschrittlichen Kräfte der neuentstandenen Ordnung ermöglichte das Entstehen sozialistischer Grundrechte. Deshalb bekämpfte die Arbeiterklasse konsequent alle Versuche reaktionärer Kräfte, diese demokratischen Rechte und Freiheiten für ihre Ziele zu mißbrauchen.«
Damit werden die Grundrechte der Verfassung von 1949 gleichsam als Übergangsrechte deklariert, die es der Arbeiterklasse und den anderen fortschrittlichen Kräften - hinzugesetzt werden muß: unter Führung der SED, die in kritischer Sicht deren Suprematie ist - ermöglichten, die Entwicklung im Sinne der marxistisch-leninistischen Geschichtsauffassung weiterzutreiben und dabei jeden Widerstand hinwegzufegen. Es muß aber, auch gegen Stimmen aus der Bundesrepublik (z. B. Georg Brunner, Die Schranken der Grundrechte in der Bundesrepublik und in der Sowjetzone, S. 95), daran festgehalten werden, daß diese Interpretation die Grenzen mißachtet, die ihr durch die im Grundrechtsteil der Verfassung von 1949 verwendeten apriorischen Rechtsbegriffe gesetzt sind, auch wenn sie sich der teleologischen Methode, die der geschichtsphilosophischen Rechtsdogmatik zugeordnet ist, bedient (Siegfried Mampel, Herrschaftssystem und Verfassungsstruktur,
S. 64 ff.).
3. Zurückbleiben der Normierung der sozialistischen Persönlichkeitsrechte
3 Während im staatsorganisatorischen Bereich die Strukturelemente und -prinzipien des sozialistischen Staates schon vor der Verfassung von 1968 weitgehend normiert waren (s. Rz. 47 zur Präambel), blieb die Normierung der sozialistischen Persönlichkeitsrechte zurück. Ansätze finden sich nur verstreut. So wurde in § 13 des Gesetzes über das Urheberrecht v. 13.9.1965 (GBl. DDR Ⅰ 1965, S. 209) das Urheberrecht als »sozialistisches Persönlichkeitsrecht« bezeichnet. Neben dem Begriff des sozialistischen Persönlichkeitsrechts wurde mehr und mehr der Begriff des sozialistischen Grundrechts verwendet. Schon 1961 wurde erklärt, daß die Ersetzung des bisher gewohnten Begriffs »Grundrechte« durch »Persönlichkeitsrechte« noch keineswegs eine allgemeine Billigung gefunden habe. Jedoch sei diese Frage sekundär, zumal Einigkeit bestehe, daß beide Begriffe synonym verwendet werden könnten (Ulrich Krüger/Eberhard Poppe, Bürgerliche Grundrechte und sozialistische Persönlichkeitsrechte, S. 1929). Deshalb wird auch häufig schlicht von »Grundrechten« gesprochen, wenn die sozialistischen Persönlichkeitsrechte oder die sozialistischen Grundrechte gemeint sind. So bezeichnet der Staatsratserlaß vom 4.4.1963 [Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die grundsätzlichen Aufgaben und die Arbeitsweise der Organe der Rechtspflege v. 4.4.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 21)] die Mitwirkung an der Gestaltung des gesamten politisch-staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und die Entscheidung über die Lebensfragen der Nation, das Recht auf Arbeit, das immer mehr zur verantwortungsbewußten Mitwirkung an der Ausarbeitung und Erfüllung der Pläne werde, den Schutz und die allseitige Förderung der von Ausbeutung und Unterdrückung befreiten Persönlichkeit, ihrer Talente und schöpferischen Fähigkeiten als reale Grundrechte der Bürger des Arbeiter-und-Bauern-Staates, die »durch den Kampf des Volkes unter Führung der Partei der Arbeiterklasse« zu diesen geworden seien. Die Normierung im einzelnen wurde der neuen Verfassung überlassen (Gerhard Haney, Sozialistisches Recht und Persönlichkeit, S. 187).
4. Keine Änderung durch die Verfassungsnovelle von 1974
4 Die Verfassungsnovelle von 1974 änderte den Wortlaut des Art. 19 nicht.

II. Die sozialistische Grundrechtskonzeption
1. Die Bedeutung der Garantie
5 Wenn Art. 19 die Frage der Garantie der Grundrechte vor allen anderen Zügen der Grundrechtskonzeption behandelt, so mag das wohl auch auf dem Bestreben beruhen, dem Vorwurf zu begegnen, in der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung würden die Grundrechte nur auf dem Papier stehen und in Wirklichkeit mißachtet. Vor allem aber liegt der Grund darin, daß die marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie dieser Frage eine entscheidende Bedeutung zumißt. Wie Dietrich Müller-Römer (Die Grundrechte in Mitteldeutschland, S. 94 ff.) und Georg Brunner (Die Grundrechte im Sowjetsystem, S. 43 ff.) in erster Linie an Hand sowjetischer Quellen nachweisen, vertritt sie unter Berufung auf Karl Marx und Friedrich Engels die Ansicht, in der bürgerlichen Gesellschaft und deren Staat hätten die in den Grundrechten proklamierten Freiheiten und die Gleichheit aller Bürger nur formale Bedeutung. Josef W. Stalin führte anläßlich der Begründung der Verfassung der UdSSR von 1936 aus: »Die bürgerlichen Verfassungen beschränken sich gewöhnlich darauf, die formalen Rechte der Staatsbürger zu fixieren, ohne sich um die Bedingungen der Verwirklichung dieser Rechte, um die Möglichkeit ihrer Verwirklichung, um die Mittel zu ihrer Verwirklichung zu kümmern. Man spricht von Gleichheit der Staatsbürger, vergißt aber, daß es keine wirkliche Gleichheit zwischen Unternehmer und Arbeiter, zwischen Gutsbesitzer und Bauer geben kann, wenn die ersteren den Reichtum und das politische Gewicht in der Gesellschaft besitzen, die anderen aber beides entbehren, wenn die ersteren die Ausbeuter und die anderen die Ausgebeuteten sind« (Fragen des Leninismus, S. 625/626). Die These vom engen Zusammenhang zwischen der Verwirklichung der Grundrechte einerseits und den Produktionsverhältnissen (der Eigentumsverfassung) sowie den auf diesen beruhenden politischen Machtverhältnissen andererseits bildet unverändert die Prämisse der marxistisch-leninistischen Grundrechtskonzeption. Ihr zufolge kommen in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung die Grundrechte nur den Besitzenden zugute, vor allem aber das Recht auf Eigentum. »Die Wirklichkeit der entstandenen bürgerlichen Gesellschaft und die einsetzenden Klassenkämpfe um das Recht auf Arbeit, auf freie Meinungsäußerung, auf Koalitionsund Versammlungsfreiheit, auf Pressefreiheit, auf soziale Sicherung und auf Begrenzung der Arbeitszeit zeigten unverhüllt, daß die zur Macht gelangte Bourgeoisie nur gewillt war, aus dem so feierlich beschworenen Menschenrechtskatalog ein einziges Recht als geheiligt und unverletzlich anzuerkennen und mit allem erdenklichen Schutz zu versehen -das Recht auf Eigentum, und zwar in der Lesart der Bourgeoisie als Recht auf Privateigentum und damit als ihr geheiligtes und unveräußerliches Recht auf Ausbeutung des Menschen« (Eberhard Poppe, Die Rolle der Arbeiterklasse .. ., S. 4).
Nach der marxistisch-leninistischen Staats- und Rechtstheorie hat erst die proletarische Revolution die Voraussetzungen für die Verwirklichung der Menschenrechte geschaffen, weil sie mit der Erringung der Herrschaft durch die Arbeiterklasse und ihre marxistisch-leninistische Partei neue gesellschaftspolitische und ökonomische Machtverhältnisse gebracht hat. Eberhard Poppe beruft sich auf die von Lenin ausgearbeitete »Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes«, die im Januar 1918 vom III. Allrussischen Sowjetkongreß bestätigt wurde und zugleich den ersten Abschnitt der im Juni 1918 in Kraft gesetzten Verfassung der RSFSR bildete und auch die Grundlage des Grundrechtsteils der Verfassung der UdSSR von 1936 wurde (a.a.O., S. 5). Mit dieser Deklaration und der Verfassung der RSFSR seien erstmalig die sozialistischen Rechte des Menschen mit Gesetzeskraft proklamiert worden. Denn: »Die Rechte eines jeden Menschen werden nur dann und dadurch realisiert und garantiert sein, wenn das werktätige Volk unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei die politische und ökonomische Macht ausübt und die Bedingungen für die Freiheit des Volkes und jedes einzelnen schafft« (Eberhard Poppe, Die Rolle der Arbeiterklasse ..., S. 6).
2. Die Garantie durch die DDR als sozialistischen Staat
6 Wenn Art. 19 Abs. 1 Satz 1 verkündet, daß die DDR allen Bürgern die Ausübung ihrer Rechte und die Mitwirkung an der Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung garantiere, so beruht dieser Verfassungssatz auf der These, daß sie dazu ihre Qualität als sozialistischer Staat befähige, also eines Staates, in dem die politische Macht von den Werktätigen unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei ausgeübt werde und als dessen unantastbare Grundlagen das feste Bündnis der Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, den Angehörigen der Intelligenz und den anderen Schichten des Volkes, das sozialistische Eigentum an Produktionsmitteln sowie die Leitung und Planung der gesellschaftlichen Entwicklung (Art. 1, Art. 2) seien. Damit ist auch Art. 19 Abs. 3 Satz 1 erklärt, wenn es darin heißt, daß jeder Bürger frei von Ausbeutung, Unterdrückung und wirtschaftlicher Abhängigkeit gleiche Rechte und vielfältige Möglichkeiten habe, seine Fähigkeiten in vollem Umfange zu entwickeln und seine Kräfte aus freiem Entschluß zum Wohle der Gesellschaft und zu seinem eigenen Nutzen in der sozialistischen Gemeinschaft ungehindert zu entfalten. Während Art. 19 Abs. 1 Satz 1 die Ausübung der Rechte der Bürger, wie sie in den Art. 21 ff. im einzelnen genannt werden, meint, betrifft Art. 19 Abs. 3 Satz 1 auch den Gleichheitssatz, wie er in Art. 20 genauer formuliert wird (s. Rz. 1-14 zu Art. 20). Es kann indessen keine scharfe Trennungslinie zwischen den staatsbürgerlichen Rechten und der Gleichheit der Bürger gezogen werden. Zwischen beiden besteht Interdependenz.
3. Das Verhältnis der sozialistischen Persönlichkeitsrechte zu den Grundrechten anderer Konzeption
7 Über das Verhältnis der sozialistischen Persönlichkeitsrechte (der sozialistischen Grundrechte) zu den Grundrechten, wie sie in den Verfassungen »bürgerlich-kapitalistischer« Staaten deklariert oder konstituiert sind, gab es in der DDR Nuancen der Auffassung. Ulrich Krüger vertrat die Ansicht, daß die Arbeiter-und-Bauern-Macht sowohl die bekannten und überkommenen Freiheitsrechte umgewandelt als auch die wichtigsten »Gestaltungsrechte« zusätzlich festgelegt habe, die über die in den Verfassungen bürgerlicher Staaten fixierten Grundrechtskataloge hinausgingen (Sozialistische Masseninitiative und Grundrechte, S. 185). Eberhard Poppe und Rolf Schüsseler dagegen meinten, der bürgerliche Grundrechtskatalog werde durch die sozialistischen Persönlichkeitsrechte gesprengt. Von einer Kontinuität der Rechtsform bzw. von einer Übernahme oder »Vervollkommnung« der bürgerlichen Grundrechte könne mithin keine Rede sein, weil die ihnen zugrunde liegenden gesellschaftlich-politischen Momente prinzipiell anders beschaffen seien, weil mit ihnen prinzipiell verschiedene gesellschaftliche Beziehungen zum Ausdruck gebracht würden, die in Inhalt und Form notwendig eine prinzipiell andere Rechtsgestaltung erforderten (Sozialistische Grundrechte und Grundpflichten der Bürger, S. 222). Der notwendige Zusammenhang zwischen der sozialistischen Gesellschaft und den sozialistischen Grundrechten werde mystifiziert, wenn zwischen solchen Grundrechten unterschieden werde, die auch in (bürgerlich-) demokratischen Verfassungen vorzukommen pflegten, und solchen, die erstmalig von einer sozialistischen Staatsmacht gewahrt und gesichert würden, meinte Hermann Klenner (Studien über die Grundrechte, S. 52/ 53). An anderer Stelle führte dieser freilich aus, daß der Marxismus eine Staatstheorie entwickelt habe, »in der die wertvollen Überlieferungen des jungen Bürgertums verarbeitet und aufbewahrt, in der sie aufgehoben« seien. In Deutschland hätten auf dem Gebiet der Grundrechtsproblematik besonders Hegel und Fichte Hervorragendes geleistet (a.a.O., S. 83/84). Auf diese Linie schwenkte Eberhard Poppe innerhalb der Diskussion über die Verfassung von 1968 ein (Der Verfassungsentwurf und die Grundrechte und Grundpflichten der Bürger, S. 536/537). Er stellte zunächst fest, eine wesentliche Erkenntnis, die sich im Entwurf der Verfassung durchgängig spiegele, bestehe darin, daß die sozialistischen Grundrechte aus den gesellschaftlichen Verhältnissen des Sozialismus selbst erwüchsen, keine bloße Weiterentwicklung bürgerlicher Grundrechte seien. In diesem Zusammenhang sprach er vom »originären« Charakter der sozialistischen Grundrechte. In einer Fußnote vermerkte er aber: »Mit der Verneinung der Kontinuität zwischen bürgerlichen und sozialistischen Grundrechten soll nicht die Tatsache negiert werden, daß die von der zur Herrschaft drängenden Bourgeoisie im Kampf gegen die Feudalherrschaft formulierten Menschen- und Bürgerrechte trotz ihrer klassenmäßigen Begrenztheit positive Züge haben.« Ähnlich äußerte er sich (Die Bedeutung der Grundrechte und Grundpflichten des Bürgers in der sozialistischen Gesellschaft, S. 326) im August 1978.
Auf der Linie dieser Argumentation bewegt sich auch das Lehrbuch »Staatsrecht der DDR«. Dort heißt es einerseits (S. 187): »Die Bejahung einer Kontinuität mit den bürgerlichen Rechten der Ausbeuterstaaten würde politisch in die Konvergenz und philosophisch in die Metaphysik einmünden; denn die bürgerliche Staatslehre motiviert die Bürgerrechte ihrer Verfassungen in Ermangelung stabiler politischer und materieller Grundlagen und Sicherungen irrational. Die Verneinung der Kontinuität zwischen den bürgerlichen und sozialistischen Grundrechten folgt auch aus der marxistisch-leninistischen Auffassung von der Unvereinbarkeit des sozialistischen Rechts mit dem bürgerlichen Recht sowie aus der Lehre von der Zerschlagung der bürgerlichen Staatsmaschine und des rechtlichen Überbaus der alten Gesellschaft.« Andererseits wird etwa später ausgeführt (S. 189): »So entschieden eine Kontinuität von bürgerlichem und sozialistischem Recht verneint werden muß, so unbedingt ist für sozialistische Grundrechte die Feststellung zu bejahen, daß die Arbeiterklasse und der Marxismus-Leninismus alle humanistischen Traditionen bewahren und sie im Hegelschen Sinne aufheben muß. Die moralischen, ideologischen und rechtlichen Vorstellungen erhalten deshalb eine völlig neue Qualität, weil sie sich in der sozialistischen Gesellschaft verwirklichen, die bestimmt ist von den neuen Produktionsverhältnissen, die sich auf der Grundlage des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln entwickeln.«
4. Die Bestimmung durch das anthropologische Vorverständnis und die Vorstellung von der Determination des Geschichtsablaufs
8 Die sozialistische Grundrechtskonzeption, welche die Abwertung der »bürgerlichen« Grundrechtskonzeption einschließt, wird durch das marxistisch-leninistische anthropologische Vorverständnis und die Vorstellung von der Determination des Geschichtsablaufs bestimmt.
9 a) Unter Anknüpfung an das Karl-Marx-Wort, das menschliche Wesen sei kein den einzelnen Individuen innewohnendes Abstraktum, sondern in seiner Wirklichkeit das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse (Thesen über Feuerbach, These 6, Ausgewählte Schriften, Band II, S. 377), wird der Mensch als »gesellschaftliches« Wesen begriffen (Eberhard Poppe, Zum sozialistischen Menschenbild in der Verfassung der DDR, S. 1452. Zur modernen Fortbildung des marxistisch-leninistischen Menschenbildes s. Rz. 35-40 zu Art. 2). Besonders Georg Brunner (Die Grundrechte im Sowjetsystem, S. 71 ff.), aber auch Dietrich Müller-Römer (Die Grundrechte in Mitteldeutschland, S. 59ff-), wiesen schon früher auf den Zusammenhang der sozialistischen Grundrechtskonzeption mit der marxistisch-leninistischen Anthropologie hin. Nach dem 1977 erschienenen Lehrbuch »Staatsrecht der DDR« (S. 183) orientiert die Verfassung den Menschen darauf, daß er ein gesellschaftliches Wesen ist.
10 b) Die Determination des Geschichtsablaufs (s. Rz. 3-12 zu Art. 1) bedeutet, daß der Mensch sich dessen Notwendigkeiten beugen muß. Daraus ergibt sich nach marxistisch-leninistischer Lehre eine zwingende Deutung des Freiheitsbegriffs. Anknüpfend an das Hegelwort von der Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit vertritt sie die Auffassung, Freiheit des Menschen existiere nur dort, wo den Erfordernissen der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen werde. In der Frühzeit des Kapitalismus sei das insoweit der Fall gewesen, als die damals aufstrebende Klasse der Bürger Freiheit gewonnen habe, während die Klasse der Besitzlosen sie weiter entbehren mußte. In der Spätzeit des Kapitalismus habe sich der Freiheitsraum der Bürger wieder verengt, so daß nur die Freiheit weniger Privilegierter (der Monopolkapitalisten) erhalten geblieben sei. Weil der Sozialismus den gesellschaftlichen Erfordernissen im Geschichtsablauf entspreche, werde in ihm die Freiheit aller und vor allem die der früher Unterdrückten und Ausgebeuteten verwirklicht. In ihm bestehe zwischen Notwendigkeit und Freiheit kein Widerspruch mehr. Insbesondere sei im Sozialismus die ökonomische Basis für die Freiheit der Persönlichkeit durch das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln geschaffen worden (Eberhard Poppe/ Angelika Zschiedrich, Freiheit von Ausbeutung - sozialistisches Grundrecht und Menschenrecht, S. 345).
11 c) Weil die geschichtliche Entwicklung sich indessen nicht im Selbstlauf entwickele, sondern von denen vorangetrieben werden müsse, die die objektiven Notwendigkeiten erkannt hätten, das heißt also von der marxistisch-leninistischen Partei als Avantgarde der Arbeiterklasse (s. Rz. 6-12 zu Art. 1), sei es diese Partei, die die Bedingungen für die wirkliche Freiheit des Menschen und damit letztlich diese selbst schaffe. Die Freiheit wird also nicht gewonnen durch »Verwirklichung irgendwelcher subjektiven Willkür«, sondern durch ihre »Verbindung mit der Gesellschaft zur Durchsetzung der objektiven Entwicklungsgesetze« (Reiner Arlt, Freiheit und Recht, S. 797/798; Walter Ulbricht, Über die Dialektik unseres sozialistischen Aufbaus, S. 165). Es ist aber die Partei, die allein weiß, was in jedem Augenblick der Entwicklung die objektive Gesetzmäßigkeit verlangt. In diesem Sinne schreibt Hermann Klenner: »Indem das von seiner Partei mobilisierte Proletariat in der sozialistischen Revolution die objektiven Gesetzmäßigkeiten der Geschichte durchsetzt, verwirklicht es sein historisches Recht auf Selbstbefreiung, sein Menschenrecht« (Studien über die Grundrechte, S. 50). Er wendet sich zwar gegen Ulrich Krüger (Sozialistische Masseninitiative und Grundrechte), weil dieser allein die »Masseninitiative« als Ursache der Verwandlung bezeichnet hatte. Diese ist aber als nichts anderes gemeint als die Initiative der von der marxistisch-leninistischen Partei geführten Massen. Offenbar erschien Hermann Klenner diese Ansicht deshalb nicht recht geheuer, weil sie zur Konsequenz hat, daß zu bestimmen, was Freiheit ist, zur Sache einer subjektiven Entscheidung der Partei wird. Er bemängelte an Ulrich Krüger, dieser habe die objektive, ökonomisch begründete Notwendigkeit unbeachtet gelassen. Jedoch ist der Unterschied der Auffassungen nicht allzu groß, weil zu erkennen, was objektive, ökonomisch begründete Notwendigkeit ist, auf jeden Fall Sache der Partei ist.
Freilich ist diese Deutung der Freiheit auch in der DDR auf Widerspruch gestoßen. Robert Havemann kritisierte in seinen Vorlesungen an der Humboldt-Universität im Wintersemester 1963/1964: »Herablassend wird uns gesagt: Wenn ihr nicht einseht, was nun einmal Notwendigkeit ist - und diese Notwendigkeit hatten gewöhnlich diejenigen bestimmt, die das sagten -, so könnt ihr eben auch keine Freiheit haben und werdet dafür eingesperrt« (Dialektik ohne Dogma?, S. 103).
In einer Auseinandersetzung mit Robert Havemann und dem österreichischen Kommunisten Ernst Fischer führte Wolfgang Loose den fundamentalen Unterschied im Freiheitsbegriff auf zwei angeblich falsche Prämissen dieser Autoren zurück, womit er den Kern des Problems trifft, weil er die Differenz auf das unterschiedliche Menschenbild und daraus folgernd auf das unterschiedliche Demokratieverständnis zurückfuhrt. Die eine Prämisse, so meinte Wolfgang Loose, bestehe in der Auffassung vom Menschen als einem abstrakten, isolierten Individuum, in der Konstruktion eines Ideals vom Menschen und der Entfaltung seiner Individualität unabhängig von den konkret-historischen Bedingungen, Möglichkeiten und Erfordernissen des internationalen Klassenkampfes, vom Entwicklungsgrad der sozialistischen Revolution in dem gegebenen Land und von der Festigung des sozialistischen Weltsystems überhaupt. Die andere bestehe darin, daß die bürgerliche Demokratie - genauer gesagt, die idealisierenden Vorstellungen von der bürgerlichen Demokratie, die von keiner jemals existierenden bürgerlichen Demokratie verwirklichten Rechte auf Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit usw. - zum absoluten Maßstab der Demokratie schlechthin erhoben und dazu noch behauptet werde, daß vom Grad der Verwirklichung dieser Rechte der bürgerlichen Demokratie die Entwicklung des Menschen zur Persönlichkeit abhinge (Sozialistischer Staat und sozialistische Persönlichkeit, S. 1594). Eine kritische Betrachtung muß einwenden, daß Wolfgang Loose, wie alle Vertreter des marxistisch-leninistischen Freiheitsbegriffs in der antiliberalen Version, übersieht, wie moderne freiheitlich-demokratische Verfassungen die Sozialbezogenheit des Menschen sehr wohl berücksichtigen, dabei aber trotzdem seine eigene Sphäre stets respektieren und ihr Schutz verheißen. Weiter ist kritisch zu bemerken, daß übersehen wird, in welchem Umfang die Verfechter der Herrschaftsform, die von den Marxisten-Leninisten »bürgerliche Demokratie« genannt wird, sich darüber im klaren sind, daß Verfassungsver-bürgungen für sich genommen noch keine Garantie der Freiheit des Menschen bedeuten, daß sie lediglich meinen, in dieser Herrschaftsform allein bestehe die Chance, die Freiheit des Menschen zu verwirklichen.
5. Die Substanz der sozialistischen Persönlichkeitsrechte
12 a) Soweit die Grundrechte nach der marxistisch-leninistischen Konzeption in ihrer antiliberalen Version Freiheiten verbürgen, richten sie sich gegen dem Sozialismus feindliche Strömungen im Inneren und gegen Einflüsse von außen, niemals aber gegen die sozialistische Gesellschaft oder den sozialistischen Staat. Die »verlogene bürgerliche Fiktion von der staatsfreien Sphäre, die durch die Bürgerrechte gesichert werden soll«, wird für die sozialistische Gesellschafts- und Staatsordnung schroff abgelehnt. Da der sozialistische Staat Machtinstrument der Werktätigen sei, brauchten sie nicht vor der Macht geschützt zu werden, die sie sich selbst revolutionär geschaffen hätten und nach ihrem Willen und Interesse ausübten (Eberhard Poppe, Der Verfassungsentwurf und die Grundrechte und Grundpflichten der Bürger, S. 535). Die Vorstellung von der Identität der Interessen von Gesellschaft und Staat einerseits und des Individuums andererseits (s. Rz. 41 ff. zu Art. 2), das »Identitätsdenken« der dogmatischen Marxisten-Leninisten (Peter Schneider, Prinzipien des totalitären Staats- und Rechtsdenkens), bestimmt die Grundrechtskonzeption. Lockert sich das Identitätsdenken auf, so hat auch das seinen Einfluß (s. Rz. 22 zu Art. 19). Im Grundsatz gilt jedoch das weiter, was Hermann Klenner (Studien über die Grundrechte, S. 53) meinte: Es sei verfehlt, wenn Gerhard Haney (Das Recht der Bürger und die Entfaltung der sozialistischen Persönlichkeit, S. 1069) die Herstellung der Einheit von Individuellem und Gesellschaftlichem nur als Ziel der Bürgerrechte bezeichne. Wegen der Identität der Interessen sei der Inhalt der sozialistischen Persönlichkeitsrechte nicht durch eine staatsffeie Sphäre charakterisiert, in der der einzelne seiner privaten Willkür nachgehen könne (eine kleinbürgerliche Vorstellung und Illusion). Das Recht des sozialistischen Staates grenze nicht das Individuum vom Kollektiv ab. Es sei individuelles und kollektives Recht zugleich. Das Recht gewähre keine Freistätte für die Absonderung einzelner vom Wege der Geschichte (a.a.O., S. 89). Im Sozialismus gebe es keine Freiheit des Bürgers vom Staat (a.a.O., S. 98). Die sozialistischen Grundrechte seien nicht Rechte der Bürger gegen ihren Staat (a.a.O., S. 100). Die Grundrechtskataloge sozialistischer Verfassungen grenzten nicht die Freiheitssphäre der Bürger von der Freiheitssphäre des Staates ab. Die sozialistischen Grundrechte seien nicht Schranke, sondern Inhalt der Volksmacht. Nach Gerhard Haney bestimmt und garantiert nicht das Maß der relativen Unabhängigkeit des einzelnen vom sozialistischen Staat die persönliche Freiheit, sondern die feste Verbindung des einzelnen mit dem Staat und der Gesellschaft (Sozialistisches Recht und Persönlichkeit, S. 185).
Auch bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft bleibt diese Auffassung maßgebend. So heißt es im Lehrbuch »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie« (S. 260), Grundrechte (und Grundpflichten) seien nicht mehr wie in der bürgerlichen Gesellschaft scheinbare individuelle Reservate des einzelnen, sie seien nicht mehr Angriffs- und Verteidigungsmittel in einer durch die Konkurrenz des Privateigentums gezeichneten Gesellschaft. Sie seien nicht mehr Mittel der Selbstbehauptung des einzelnen in einer ihm feindlichen Gesellschaft gegenüber einem ihn unterdrückenden Staat.
13 b) In bezug auf Gesellschaft und Staat tritt in der marxistisch-leninistischen Grundrechtskonzeption an die Stelle der Frage nach der Freiheit »wovon« die Frage nach der Freiheit »wozu«. Die Antwort lautet: zur Mitgestaltung der sozialistischen Gesellschaft und des sozialistischen Staates. Deshalb steht in der Verfassung von 1968/1974 der Grundrechtsteil hinter dem Abschnitt über die Grundlagen der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung (s. Rz. 56 zur Präambel).
Ulrich Krüger und Eberhard Poppe schrieben bereits im Jahre 1961 in einem Tagungsbericht (Bürgerliche Grundrechte und sozialistische Persönlichkeitsrechte, S. 1921) im Anschluß an die Ausführungen Walter Ulbrichts auf dem V. Parteitag der SED (s. Rz. 2 zu Art. 19), es gehe darum, »jeden Bürger mit Hilfe des Staates und seines Rechts auf den Weg der sozialistischen Entwicklung, das heißt der bewußten Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, zu führen, damit die sozialistische Persönlichkeit zu formen, alle Fähigkeiten und Kräfte der Menschen zur Entfaltung zu bringen«. Nach Hilde Benjamin (Das Recht der sozialistischen Persönlichkeit, Neues Deutschland vom 9.9.1958) bedeutet das sozialistische Persönlichkeitsrecht auch Freiheit, aber Freiheit zur vollen Entfaltung der Kräfte eines jeden einzelnen. Ulrich Krüger nannte die sozialistischen Persönlichkeitsrechte »Gestaltungsrechte« (Sozialistisches Recht und Persönlichkeit, S. 185), Hermann Klenner das Persönlichkeitsrecht »das Recht der Bürger auf Entfaltung seiner Fähigkeiten durch die Betätigung im Kampf um den Sieg des Sozialismus« (Studien über die Grundrechte, S. 106). In bezug auf die Verfassung von 1968 bezeichnete Eberhard Poppe die sozialistischen Grundrechte als »verbindliche Verhaltensnormen«, als »Betätigungsvollmachten« (Der Verfassungsentwurf und die Grundrechte und Grundpflichten der Bürger, S. 538). So wird das Recht auf Mitgestaltung (Art. 21) zum »Mutterrecht« der sozialistischen Grundrechte, die sich auf die Tätigkeit der Bürger in Gesellschaft und Staat beziehen. Von ihm aus wird die Systematik dieser Grundrechte entwickelt (s. Rz. 6-10 zu Art. 21).
Im Jahre 1977 rangen sich Carola Luge/Richard Mand/Rudi Rost (Sozialismus und Menschenrechte, S. 792) im Zusammenhang mit der Menschenrechtsdiskussion (s. Rz. 40-45 zu Art. 19) zur These durch, die sozialistischen Menschenrechte, die den sozialistischen Grundrechten entsprächen, gewährleisteten nicht nur die Freiheit »für«, d. h. für die aktive schöpferische Tätigkeit der Persönlichkeit auf der Grundlage der bewußt gewordenen Notwendigkeit, sondern auch die Freiheit »von«, d. h. von ungesetzlichen Beschränkungen und Einmischungen in das Leben der Persönlichkeit. Nach wie vor geht es aber nicht um die Freiheit vom Staate im Sinne der Respektierung einer staatsfreien Sphäre. Daran läßt das Lehrbuch »Staatsrecht der DDR« keinen Zweifel, wo es im Zusammenhang mit der Frage der Grundrechte als subjektive Rechte (s. Rz. 21-31 zu Art. 19) heißt (S. 185), die Bejahung der Eigenschaft als subjektives Recht bedeute nicht, daß die sozialistischen Grundrechte subjektive Rechte im Sinne der bürgerlichen Konzeption seien, wonach durch die Bürgerrechte angeblich eine staatsfreie Sphäre gesichert wäre.
14 c) Weil die Mitgestaltung in der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung sich nach der Notwendigkeit richten muß, die sich aus der angeblich objektiven Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung ergibt, und diese Gesetzmäßigkeit nur von der marxistisch-leninistischen Parteiführung erkannt werden kann (s. Rz. 9 zu Art. 1), muß eine kritische Betrachtung zum Ergebnis gelangen, daß die von den sozialistischen Grundrechten verlangte Betätigung der Bürger sich nur innerhalb der Grenzen bewegen darf, die ihr von der Parteiführung gesetzt sind. Die sozialistischen Grundrechte werden also durch die Suprematie der marxistisch-leninistischen Parteiführung immanent beschränkt. Nach Eberhard Poppe (Der Verfassungsentwurf und die Grundrechte und Grundpflichten der Bürger, S. 538/539) liegen Einschränkungen im objektiv begründeten Interesse der Gemeinschaft und der Bürger selbst. Wenn er meint, diese gebe es nur bei einigen, so steht das im Gegensatz zu seiner Feststellung, die Verfassung achte sorgfältig darauf, daß die Grundrechte »nicht gegen die Macht des Volkes und seine sozialistische Demokratie mißbraucht werden können, niemandem die Möglichkeit gegeben wird, diese Rechte zum Nachteil von Mitbürgern anzuwenden«. Denn dies gilt für alle Grundrechte. Wenn er weiter meint, Anliegen der Verfassung sei es, die Substanz und die Zielstellungen nicht antasten zu lassen, so wird die immanente Beschränkung der Grundrechte damit bestätigt; denn die Zielstellungen bestimmen die Substanz. Seine Ausführungen über die Grenzen der Gewissens- und Glaubensfreiheit und des Rechts auf freie Wahl des Arbeitsplatzes (Die Rolle der Arbeiterklasse ..., S. 9) legen dafür Zeugnis ab (s. Rz. 15-19 zu Art. 20, Erl. zu Art. 24).
Es kann freilich nicht übersehen werden, daß es die Führung der marxistisch-leninistischen Partei auch in der Hand hat, die immanente Beschränkung der Grundrechte zu lok-kern, wenn sie das will. Eine solche Entwicklung, die von der Verfassung gedeckt wäre, würde den Freiheitsraum der Bürger erweitern. Die Ansicht Ernst Richerts (Macht ohne Mandat), sie müsse solches tun, »wenn bis dato gesetzte mittelfristige Ziele (dahingehend gedeutete gesellschaftliche Erfordernisse) sich als nicht mehr mit unübersehbaren individuellen und kollektiven Interessen der Bürgerschaft vereinbar erweisen oder wenn der Präferenzkatalog der Erfordernisse sehr gravierend korrekturbedürftig wird«, mag langfristig zutreffen. In der gegenwärtigen Phase der Entwicklung ist ein derartiger Optimismus indessen spekulativ. Die These von Klaus Sorgenicht, der unter Berufung auf Kurt Hager (Sekretär des ZK der SED) schrieb, der sozialistische Staat gewähre der Persönlichkeit umfassende Rechte und Freiheiten, deren Grenzen nur dort gezogen seien, wo ihre Überschreitung die Interessen der sozialistischen Gesellschaft schädige (Oktoberrevolution und Menschlichkeit, S. 1115), hat keine Änderung der Situation gebracht. Denn was die Interessen der sozialistischen Gesellschaft in der DDR sind, bestimmt unverändert die Führung der SED in einem für die Freiheit der Bürger restriktiven Sinne.
15 d) Trotz der Immanenz der Beschränkungen werden diese zuweilen in der Formulierung der einzelnen Grundrechte ausgedrückt. Dabei werden Wendungen wie »den Grundsätzen der Verfassung gemäß« (Art. 27 - Meinungsfreiheit), »im Rahmen der Grundsätze und Ziele der Verfassung« (Art. 28 - Versammlungsfreiheit), »in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Zielen der Verfassung« (Art. 29 - Vereinigungsfreiheit) verwendet. In bezug auf andere Grundrechte, etwa bei der Gewissens- und Glaubensfreiheit (Art. 20 Abs. 1 Satz 2), fehlt eine solche Formel, ohne daß sich an der! Beschränkung etwas änderte. Bezüglich der Garantie für die Unantastbarkeit der Persönlichkeit und der Freiheit des Bürgers (Art. 30 Abs. 1) werden dagegen die zulässigen Beschränkungen im Abs. 2 präzisiert (s. Rz. 9-42 zu Art. 30).
Im übrigen ergibt sich der Umfang der Beschränkungen vielfach aus der einfachen Gesetzgebung. Aus ihr ist vor allem zu entnehmen, wie Inhalt und Umfang der sozialistischen Grundrechte interpretiert werden.
16 e) Als Rechte auf Mitgestaltung in der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung können die sozialistischen Grundrechte nur den Mitgliedern einer konkreten Gesellschaft zustehen, nicht aber den Menschen schlechthin. Sie sind daher als »Bürgerrechte«, nicht als »Menschenrechte« konzipiert.
Soweit den Bürgern anderer Staaten oder Staatenlosen Rechtspositionen eingeräumt werden, können diese nicht aus dem Recht auf Mitgestaltung hergeleitet werden. Nach dem Lehrbuch »Staatsrecht der DDR« (S. 194) liegt es in der internationalistischen Haltung der DDR begründet, daß sie im wesentlichen auch den Bürgern anderer Staaten und Staatenlosen, die sich in der DDR aufhalten, die Grundrechte und Grundfreiheiten gewährt. Normativ bestimmt § 4 Satz 1 des Ausländergesetzes vom 28.6.1973 [Gesetz über die Gewährung des Aufenthaltes für Ausländer in der Deutschen Demokratischen Republik - Ausländergesetz - i. d. F. v. 28.6.1979 (GBl. DDR Ⅰ 1979, S. 149)], daß Ausländer, die sich in der DDR aufhalten, die gleichen Rechte - soweit diese nicht an die Staatsbürgerschaft der DDR gebunden sind - wie Staatsbürger der DDR haben. (Wegen der Asylgewährung in Art. 23 Abs. 3 s. Rz. 36 ff. zu Art. 23).
6. Die Grundpflichten
17 a) Aus der objektiv begründeten Einheit der Interessen von Individuen und Gesellschaft ergibt sich nach der marxistisch-leninistischen Konzeption eine Einheit von Grundrechten und Grundpflichten. Schon auf einer Tagung der Sektion Staatstheorie und Staatsrecht im Juni 1961 wurde von dieser Einheit gesprochen (Ulrich Krüger/Eber-hard Poppe, Bürgerliche Grundrechte und sozialistische Persönlichkeitsrechte, S. 1931). Hermann Klenner vertrat die Ansicht, daß dort, wo ein sozialistisches Persönlichkeitsrecht gegeben sei, auch die Pflicht bestehe, es auszuüben (Studien über die Grundrechte, S. 78). Ähnlich argumentierte Gerhard Haney (Sozialistisches Recht und Persönlichkeit, S. 213). Eberhard Poppe/Rolf Schüsseler (Sozialistische Grundrechte und Grundpflichten der Bürger) meinten, daß es durchaus gerechtfertigt sei, die Rechte und Pflichten als zwei Seiten ein und derselben Sache zu bezeichnen, in diesem Sinne bestehe die unbedingte Einheit von Rechten und Pflichten, von verfassungsgesetzlich fixierten Möglichkeiten und gebotenen Verhaltensweisen. Sie schränkten diese These aber insoweit ein, als sie meinten, die Pflichten seien nicht in jedem Falle Rechtspflichten, sie könnten auch Moralpflichten sein. Dieselben Autoren vertraten gemeinsam mit Willi Büchner-Uhder (Grundrechte und Grundpflichten der Bürger ...) später die Auffassung, die These von der Identität von Grundrechten und Grundpflichten sei nicht unbedenklich. Die Rechte gingen über die Pflichten hinaus, z. B. sei das Recht auf Arbeit weitergehend als die Pflicht zur Arbeit (s. Erl. zu Art. 24). Man könne bestenfalls von einer partiellen Identität sprechen. Die Einheit von Rechten und Pflichten werde dadurch nicht aufgehoben.
Bei der Begründung des Verfassungsentwurfs meinte Walter Ulbricht (Die Verfassung des sozialistischen Staates deutscher Nation, S. 352): Mehr Rechte durch größere Verantwortung und höhere Verantwortung durch erweiterte Rechte, so bildeten die Grundrechte und die Pflichten des Bürgers im Sozialismus eine Einheit. Eberhard Poppe (Der Verfassungsentwurf und die Grundrechte und Grundpflichten der Bürger, S. 540) führte dazu aus, die Gesellschaft könne den Staat nur schützen, wenn er ihren Bestand schütze und festige. Sie könne die Ansprüche des einzelnen nur mit den Mitteln schützen, die er für den gesellschaftlichen Reichtum miterarbeitet habe. Deshalb verbinde der Verfassungsentwurf die Regelung der Grundrechte des Bürgers mit der Bestimmung seiner staatsbürgerlichen Pflichten. Diese Pflichten korrespondierten mit den Prinzipien der sozialistischen Moral, die für die Masse der Bürger ohnehin selbstverständliche Verhaltensmaximen seien.
Er fügte alsdann eine weitere Rechtfertigung für die Begründung der Rechtspflichten an. Durch sie würden die Bürger davor geschützt, daß einige wenige auf ihre Kosten leben wollten und die gesellschaftliche Entwicklung hemmten. Die Rechtspflichten der einzelnen Bürger haben danach Schutzcharakter nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch für die jeweils anderen Bürger.
Zum Verhältnis der Rechte und Pflichten meinte er nunmehr, ihre wechselseitige Bedingtheit finde im Grundrechtsteil doppelten Ausdruck. Sie sei widergespiegelt in der Tatsache, daß er ein bestimmtes staatsbürgerliches Verhalten im Interesse des Bestandes, Schutzes und der Entwicklung der Gesellschaft verbindlich regele. Aber auch die Fixierung der Pflichten in organischer Verbindung mit den Rechten und nicht als Annex zum Grundrechtskatalog soll die Einheit von Rechten und Pflichten reflektieren. Er fährt fort: »Die wohlüberlegte, sehr sparsame Regelung ausdrücklicher Rechtspflichten vermag dabei zu zeigen, daß der Grundrechtsteil der mitunter geäußerten Ansicht von der durchgängigen Identität von Rechten und Pflichten, die bedeutende sozialistische Errungenschaften völlig überflüssig mit dem Attribut staatlicher Erzwingbarkeit behaften würden, keine tragfähige Grundlage bietet.«
18 Traute Schönrath (Einheit von Rechten und Pflichten in der sozialistischen Gesellschaft, S. 1717) wandte sich in einem Diskussionsbeitrag im Anschluß an den sowjetischen Autor L. D. Wojewodin gegen die Auffassung von Gerhard Haney und pflichtete dem genannten sowjetischen Autor darin bei, daß es zwar Grundrechte gebe, deren Inhalt Befugnisse des Bürgers, nach seiner Wahl zu handeln, mit dem Hinweis auf ein bestimmtes notwendiges Handeln verbindet. Aber das treffe bei weitem nicht für alle Grundrechte zu. Das Lehrbuch »Staatsrecht der DDR« (S. 190) ist in dieser Frage unklar, scheint aber der Ansicht zuzuneigen, daß nicht jedes Grundrecht mit einer Rechtspflicht gekoppelt ist. Denn es sagt, daß jeder Bürger in untrennbarer Einheit mit den Grundrechten auch bestimmte Grundpflichten habe, spricht dann aber wie Eberhard Poppe (s. o.) von der sehr sparsamen, aber ausdrücklichen Regelung verfassungsrechtlicher Grundpflichten, die der Tatsache entspreche, daß sozialistische Verfassungen offen das gesellschaftlich Notwendige darlegten und verbindlich regelten. Diese Grundpflichten orientierten den Bürger auf ein unerläßliches aktives Verhalten in der sozialistischen Gemeinschaft (S. 191).
19 So wird die Einheit von Grundrechten und Grundpflichten nach wie vor bejaht. Indessen sollen die Pflichten, die mit den Rechten als korrespondierend, aber nicht mit ihnen identisch angesehen werden, nicht durchgängig Rechtspflichten sein. Sie sollen es nur dann sein, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet oder kenntlich sind. Ob mit jedem Grundrecht, das nicht mit einer Rechtspflicht verbunden ist, eine moralische Pflicht gekoppelt ist, bleibt offen. In manchen Fällen wird eine moralische Pflicht ausdrücklich festgelegt, etwa in Art. 21 Abs. 3 Satz 1 (Verpflichtung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung). Da es sich hier um das »Mutterrecht« aller Grundrechte handelt (s. Rz. 9,10 zu Art. 21), könnte vom Bestehen einer moralischen »Mutterpflicht« ausgegangen werden, was zur Annahme führen kann, alle Grundrechte wären als Tochterrechte mit moralischen Pflichten gekoppelt (s. Rz. 26, 27 zu Art. 21).
Im übrigen kann sich nach dem Text der Verfassung aus einer »Ehrenpflicht«, also einer moralischen Pflicht, eine konkrete Rechtspflicht ergeben. So wird in Art. 23 Abs. 1 Satz 2 der Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes als Recht und Ehrenpflicht der Bürger bezeichnet. Im folgenden Satz wird aber jeder Bürger zum Dienst und zu Leistungen für die Verteidigung entsprechend den Gesetzen, also erzwingbar, verpflichtet.
20 b) In der Verfassung findet die Festlegung von Pflichten in zweifacher Weise statt. Im Grundrechtsteil werden Pflichten mit den Rechten verbunden, so in Art. 21 Abs. 3 (Pflicht zur Verwirklichung des Rechts auf Mitbestimmung und Mitgestaltung), Art. 23 Abs. 1 (Pflicht zum Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes), Art. 24 Abs. 2 Satz 2 (Pflicht zur Arbeit), Art. 25 Abs. 4 Satz 3 (Pflicht der Jugendlichen zur Erlernung eines Berufs). Hier sind Rechte und Pflichten »organisch« miteinander verbunden (Eberhard Poppe, Der Verfassungsentwurf ..., S. 540). Außerhalb des Grundrechtsteils sind Pflichten der Bürger festgelegt, ohne daß gleichzeitig ein besonderes Recht konstituiert wird, so die Pflicht zum Schutz und zur Mehrung des Volkseigentums (Art. 10 Abs. 2) sowie zur Reinhaltung der Gewässer und der Luft, zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt und der landschaftlichen Schönheiten der Heimat (Art. 15 Abs. 2). Hier ist als korrespondierendes Recht das »Mutterrecht« auf Mitbestimmung und Mitgestaltung anzunehmen.
7. Die sozialistischen Persönlichkeitsrechte - subjektive Rechte?
21 a) Die Frage liegt nahe, warum in Anbetracht der behaupteten Qualität der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung es überhaupt für notwendig gehalten wird, die Grundrechte verfassungsrechtlich zu normieren. Eberhard Poppe (Die Rolle der Arbeiterklasse ..., S. 8) beantwortet sie damit, die in der sozialistischen Gesellschaft wirkenden (gesellschaftlichen) Gesetze bedürften zu ihrer Verwirklichung des bewußten und aktiven Handelns der Menschen; das erst ermögliche ihre Durchsetzung. Grundrechte orientierten die Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft auf das notwendige aktive Handeln, wie es die gesellschaftliche Entwicklung erfordere. Die sozialistische Arbeiter-und-Bauem-Macht bringe mit ihnen zum Ausdruck, daß die allseitige Persönlichkeitsentfaltung Inhalt und Ziel der sozialistischen Gesellschaft, ihres Staates und ihres Rechts sei, aber es dazu auch unabdingbar der Tätigkeit der Bürger selbst bedürfe. Die Bürger selbst müßten die aus dem Kapitalismus übernommenen Beschränkungen und Behinderungen ihrer Persönlichkeitsentfaltung, die Ungleichheit, die Unterschiedlichkeit der Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten überwinden und alle Bedingungen für eine freie und gleiche Entfaltung ihrer Persönlichkeit schaffen. Damit alle Bürger diese Erkenntnis gewönnen, sei es notwendig, die noch nicht von jedem erkannten und verstandenen objektiven Gesetzmäßigkeiten als juristische Normen zu verankern und sie damit stärker und verbindlicher im Bewußtsein jedes einzelnen einzuprägen.
22 b) In diesem Zusammenhang wiederholt Eberhard Poppe seine schon mehrmals vorgetragene These, die sozialistischen Grundrechte seien subjektive Rechte. Gegen diese Auffassung hatten sich Karl Polak (Zur Lage der Rechts- und Staatswissenschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, S. 1359) und Gerhard Haney (Das Recht der Bürger
und die Entfaltung der sozialistischen Persönlichkeit, S. 1079) gewendet, weil sie die Konzeption von subjektiven Rechten für die sozialistische Rechtsordnung ablehnten. Eberhard Poppe hatte dagegen gemeinsam mit Rolf Schüsseler (Sozialistische Grundrechte und Grundpflichten der Bürger, S. 221) schon 1963 ihre Natur als subjektive Rechte bejaht.
Sie hatten damals ihre Ansicht damit begründet, daß
(1) auch im Sozialismus der Staat noch fortbestehe und deshalb unvermeidlich ein gewisser Gegensatz zwischen staatlichen Organen und Bürgern bestehe, der aber nicht mehr unüberbrückbar sei,
(2) die konkreten Bedingungen, unter denen namentlich die örtlichen Organe tätig würden, nicht überall einheitlich seien,
(3) auch in der sozialistischen Ordnung die individuellen Lebensbedingungen eine Zeitlang ungleich seien.
Eberhard Poppe bekräftigte bei der Erläuterung des Verfassungsentwurfs seine Ansicht (Der Verfassungsentwurf ..., S. 538). Auch führt die neuere Erkenntnis von der Existenz verschiedener Interessenebenen in der sozialistischen Gesellschaft (s. Rz. 42 zu Art. 2), gepaart mit der Vorstellung vom Zusammenhang der Interessen mit den Grundrechten zur Frage der rechtlichen Sicherung der Interessen von Individuen und Kollektiven gegen den Staat als Sachwalter der gesamtgesellschaftlichen Interessen. Wenn Gerhard Haney und Helmut Oberländer (Sozialistische Staatlichkeit ohne Bewußtsein?, S. 93) die Ansicht vertreten, die sozialistische Gesellschaft habe den Gegensatz zwischen objektivem und subjektivem Recht beseitigt, weil sie den antagonistischen Widerspruch zwischen gesellschaftlichen und individuellen Interessen aufgehoben habe, so geht auch diese Ansicht vom Zusammenhang der Grundrechte und der Interessen aus. Jedoch scheinen diese Autoren nach wie vor der Auffassung von den sozialistischen Grundrechten als subjektiven Rechten skeptisch gegenüberzustehen; denn sie betonen, daß der Schutz der Rechte des einzelnen (oder der Kollektive) Schutz der sozialistischen Rechtsordnung als Ganzer sei. Das verwundert nicht bei Autoren, die in erster Linie die Aufhebung des antagonistischen Widerspruchs der Interessen sehen, aber offensichtlich die verbleibenden Differenzen nicht für beachtenswert halten.
Nach dem Lehrbuch »Staatsrecht der DDR« (S. 185) sind die Grundrechte zugleich als subjektive Rechte der Bürger zu verstehen.
23 c) Der Begriff des subjektiven Rechts, wie er von der Rechtslehre in der DDR verwendet wird, bedarf einer Klärung. Eberhard Poppe unterschied zunächst nicht, wie er in seinem Aufsatz »Die Rolle der Arbeiterklasse ...« erkennen ließ, zwischen der objektiven Rechtsordnung und den subjektiven Rechten, sondern zwischen den »objektiven Gesetzen«, womit er die angeblich objektive Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung meinte, und den subjektiven Rechten. Er ließ nicht erkennen, ob er, wenn er von »subjektiven Rechten« sprach, darunter Reflexe der objektiven Rechtsordnung, die einen Anspruch des Bürgers gegen den Staat oder Dritte (Drittwirkung der Grundrechte) nicht begründen, oder eine Position versteht, die einen solchen verschafft.
Im Jahre 1978 erklärte Eberhard Poppe (Die Bedeutung der Grundrechte und Grund-pflichten des Bürgers in der sozialistischen Gesellschaft, S. 328) wiederum, die sozialistischen Grundrechte und Grundpflichten verkörperten objektive gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten, fügte nunmehr aber hinzu: »Sie sind objektives Recht, weil sie die Bürger auf ein gesellschaftlich notwendiges Handeln orientieren, das für die Entwicklung der Gesellschaft wie des Bürgers unerläßlich ist.« Damit werden die sozialistischen Grundrechte als objektives Recht und Quelle subjektiver Rechte deklariert.
Nach dieser Auffassung scheint das sozialistische Grundrecht den Charakter einer Position zu haben, die Ansprüche gegen den Staat schafft. In einer kritischen Betrachtung meint dagegen Dietrich Müller-Römer (Die Grundrechte im neuen mitteldeutschen Verfassungsrecht, S. 312), die Grundrechte in der DDR seien keine subjektiven öffentlichen Rechte. Er fuhrt dafür ins Feld, in der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung werde der einzelne nicht mehr wie im »bürgerlichen Klassenstaat« als dem Staat gegenübergestellt angesehen, sondern als Bestandteil der im Staat organisierten Gesellschaft, weil die allgemeinen und die individuellen Interessen als identisch betrachtet würden. Damit seien die Voraussetzungen entfallen, unter denen allein von subjektiven Rechten gesprochen werden könne. Im Kern ist dieser Kritik zuzustimmen. Ihre Begründung bedarf jedoch einer differenzierenden Betrachtungsweise, insbesondere deshalb, weil in der neuesten Entwicklung in der Grundrechtskonzeption von einer »gewissen Gegensätzlichkeit zwischen staatlichen Organen und Bürgern« ausgegangen wird.
24 d) Zunächst ist zu beachten, daß die marxistisch-leninistische Staats- und Rechtslehre der Frage der Garantie der Grundrechte so große Bedeutung beimißt, daß dieser Wesenszug sogar an die Spitze des Grundrechtsteils der Verfassung gestellt ist (s. Rz. 5 zu Art. 19). Hermann Klenner (Zu unbewältigten Grundrechtsproblemen, Demokratie und Grundrechte, S. 119) wies auf diese Frage hin. Sie ist näher zu untersuchen.
Eberhard Poppe unterteilt die Garantien in politische, ideologische, ökonomische, juristische und »andere« (Der Verfassungsentwurf ..., S. 534). Er spricht von einem System der Grundrechtsgarantien. Die politische Garantie sieht er in der vom Volk geschaffenen Gesellschafts- und Staatsordnung, in der Herrschaft der Arbeiter und Bauern unter Führung der Partei der Arbeiterklasse. Die ideologische Garantie besteht ihm zufolge in der wissenschaftlichen Weltanschauung des Marxismus-Leninismus und dem sozialistischen Staatsbewußtsein, die ökonomische Garantie im sozialistischen Eigentum an Produktionsmitteln und der neuen Form der Planung und Leitung, innerhalb derer die Werktätigen das Recht hätten, Einfluß auf die prinzipielle Gestaltung der Wirtschaft zu nehmen (Die Rolle der Arbeiterklasse ..., S. 15). Hier wird nichts anderes genannt, als was die Qualität der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung ausmacht (s. Rz. 6 zu Art. 19). Es handelt sich hier um generelle Garantien. Wenn nach Art. 86 die sozialistische Gesellschaft, die politische Macht des werktätigen Volkes, ihre Staats- und Rechtsordnung als die grundlegenden Garantien für die Einhaltung und die Verwirklichung der Verfassung im Geiste der Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Menschlichkeit bezeichnet werden, so wird mit diesem Satz, der den Abschnitt über die sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtspflege einleitet, dieser Gedanke nochmals aufgenommen. Er schließt die Einhaltung und Verwirklichung der in der Verfassung verankerten Grundrechte ein (s. Erl. zu Art. 86). Diese Garantien könnne aber nichts anderes bewirken, als daß sie die Voraussetzungen für die Ausübung der Grundrechte schaffen. Das ist nicht ohne Belang. Es kann davon ausgegangen werden, daß die sozialistische Gesellschafts- und Staatsordnung für die sozialistischen Grundrechte in ihrer durch die Zielsetzung beschränkten Substanz - freilich auch nur in dieser - solches leistet. Diese Garantien besagen aber noch nichts darüber, was geschehen soll, falls die sozialistischen Grundrechte doch verletzt werden. Daß ein solcher Fall möglich ist, wird nunmehr, wie gezeigt (s. Rz. 22 zu Art. 19), zugegeben.
25 e) Deshalb sind die besonders in der Verfassung geregelten juristischen Garantien einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Diese scheinen am ehesten geeignet, die Frage zu lösen, welchen Schutz der einzelne vor Verletzung seiner Grundrechte hat. Eberhard Poppe (Die Rolle der Arbeiterklasse ..., S. 15) weist hierbei auf die Regelungen des Art. 19 Abs. 1 und 2 hin. Bedeutung könnte vor allem der Verfassungsauftrag zur Gewährleistung der sozialistischen Gesetzlichkeit und der Rechtssicherheit in Art. 19 Abs. 1 Satz 2 haben. Jedoch handelt es sich hier, ebenso wie bei der behaupteten Qualität des sozialistischen Staates, um eine generelle Garantie (s. Rz. 46 zu Art. 19). Mit ihr wird für die anstehende Frage nichts gewonnen. Eberhard Poppe argumentiert deshalb folgerichtig weiter.
Er meint, neben den generellen Garantien seien alle Grundrechte mit speziellen, in der Verfassung näher bezeichneten Garantien ausgestattet. Bei einer Beeinträchtigung seiner Rechte könne jeder Bürger staatlichen oder gesellschaftlichen Rechtsschutz beanspruchen und könne die zuständigen staatlichen Organe verpflichtend ersuchen, ihm bei der Wiederherstellung beziehungsweise Sicherung des verletzten Grundrechts Unterstützung geben. Er verweist dabei auf Art. 30 Abs. 3.
Angelika Zschiedrich (Probleme der juristischen Garantien der grundlegenden Rechte der Bürger, S. 1178) bezeichnet die juristischen Garantien neben den politischen, ökonomischen und ideologischen Grundrechtsgarantien als eine »spezielle« Art, mit deren Hilfe die grundlegenden Rechte der Bürger unmittelbar gewährleistet bzw. geschützt werden. Dazu gehören Normen, durch die die Staatsorgane verpflichtet werden, die Rechte und Freiheiten der Bürger zu schützen, wie etwa der Ministerrat [§ 1 Abs. 8 Satz 2 Gesetz über den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik (MinRG) v. 16.10.1972 (GBl. DDR Ⅰ 1972, S. 253)] oder kraft Verfassungsrechts (Art. 41) die sozialistischen Betriebe, Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie nach einfachem Gesetzesrecht die örtlichen Volksvertretunten [§ 2 Abs. 6 Satz 1 Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe in der Deutschen Demokratischen Republik (GöV) v. 12.7.1973, (GBl. DDR Ⅰ 1973, S. 313)].
Nach Angelika Zschiedrich (a.a.O., S. 1181) schließt der Schutz der Rechte der Bürger mittels der juristischen Garantien ein, Rechtsverletzungen jeglicher Art vorzubeugen und Rechtsmittel zu gewähren, mit deren Hilfe die Bürger unmittelbar jeder rechtswidrigen Einschränkung oder Verletzung ihrer grundlegenden Rechte wirksam begegnen könnten (S. 1180).
26 f) Damit wird die essentielle Bedeutung des Rechtsschutzes für das subjektive Recht anerkannt. In der deutschen Rechtsentwicklung hat sich der Begriff des subjektiven (öffentlichen) Rechts gebildet, als die Abwendung von patriarchalischen, patrimonialen Vorstellungen über Berechtigungen, Verpflichtungen, Schutz- und Fürsorgepflichten vollzogen war und dem einzelnen eine Rechtsposition eingeräumt wurde, die ihn in die Lage versetzte, öffentlich-rechtliche Ansprüche nicht nur verbal geltend zu machen, sondern auch durchzusetzen. (Zum Begriff und der Problematik des subjektiven [öffentlichen] Rechts vor allem: Ernst Forsthoff, S. 185 ff., mit weiteren Quellennachweisen).
Das subjektive (öffentliche) Recht ist ein Institut, das in eine bestimmte Rechtsordnung eingeschlossen ist. Diese ist so gestaltet, daß der Bürger durch Inanspruchnahme von Rechtsschutz die staatlichen Organe zu einem Tun oder einem Unterlassen zwingen kann. Dafür sind die Existenz und das Funktionieren von Organen, die andere Organe verbindlich anweisen können, unabdingbare Voraussetzung. Weitere unabdingbare Voraussetzung ist, daß diese Organe unabhängig von den von ihnen angewiesenen Organen sind. Andererseits dürfen auch die angewiesenen Organe nicht in einem generellen Unterstellungsverhältnis zu den anweisenden Organen stehen. Sonst könnten die anweisenden Organe sich in jedem beliebigen Falle an die Stelle der angewiesenen Organe setzen und würden damit verantwortlich für deren gesamtes Handeln oder Unterlassen werden. Mit anderen Worten: eine solche Rechtsordnung ist nur gegeben, wenn sie nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung strukturiert ist. Die Funktionen der Legislative und der Exekutive, mit Hilfe derer der Staat generell tätig wird, dürfen nicht den Organen übertragen sein, denen die Funktion des Rechtsschutzes im Einzelfalle zukommt. Nur so kann eine Rechtsschutzgarantie wirksam sein. Die Organe, die mit allen Attributen der Unabhängigkeit ausgestattet sind, sind im Staate mit Gewaltenteilung allein die Gerichte, deren Existenz und Funktion das subjektive (öffentliche) Recht einklagbar machen. Ob es rechtstheoretisch richtig ist, den Begriff des subjektiven (öffentlichen) Rechts von seiner Einklagbarkeit zu trennen, wie es Emst Forsthoff für zutreffend hält, erscheint zweifelhaft.
Aber auch er weist darauf hin, daß ein in einem hohen Maße auf dem gerichtlichen Rechtsschutz beruhendes System auf die praktische Anwendung des Begriffs des subjektiven (öffentlichen) Rechts von großem Einfluß ist. Es fragt sich ganz allgemein, also auch im Hinblick auf die DDR, was der Begriff leisten soll, wenn man nur die Existenz eines subjektiven (öffentlichen) Rechts als Voraussetzung der Zulässigkeit einer Klage ansieht, aber die Einklagbarkeit nicht mehr als sein Kriterium betrachtet. Nicht jede Beschränkung staatlicher Funktionen begründet schon ein subjektives (öffentliches) Recht. Es muß unterschieden werden zwischen Beschränkungen und Bindungen, welche den öffentlichen Zwecken dienen, und solchen, die im Interesse und zum Schutz der vom Verwaltungshandeln - im Hinblick auf mögliche legislative Eingriffe in verfassungsrechtlich geschützte Rechte kann schlechthin von staatlichem Handeln gesprochen werden - betroffenen Rechtsgenossen bestehen. Auch die Beschränkungen und Bindungen, die den öffentlichen Zwecken dienen, können den einzelnen begünstigen. Nur gewinnt er aus dieser Position nicht einen einklagbaren Anspruch, auch nicht in Anbetracht der im modernen Rechtsstaat an wachsenden Tendenz, den Kreis der subjektiven (öffentlichen) Rechte immer mehr zu erweitern und nicht nur konkrete, speziell geschützte Rechte, sondern auch eine geschützte Position, einen bestimmten öffentlich-rechtlichen Besitzstand oder eine Anwartschaft als Substrat eines subjektiven (öffentlichen) Rechts anzusehen. Gerade um den Unterschied deutlich zu machen, der zwischen einer Position steht, die nur der Reflex der objektiven Rechtsordnung ist und keinen Anspruch begründet, und einem subjektiven (öffentlichen) Recht, ist auch die Durchsetzbarkeit des Anspruchs im Klagewege vor mit allen Attributen der Unabhängigkeit ausgestatteten Gerichten als Essentiale des subjektiven (öffentlichen) Rechts anzusehen. In der rechtstheoretischen Entwicklung des Instituts »subjektives (öffentliches) Recht« steht sicher der Anspruch vor der Möglichkeit seiner Durchsetzung. Aber dennoch sind beide als Einheit anzusehen. Anderenfalls wäre es denkbar, daß es subjektive (öffentliche) Rechte gäbe, die im Klagewege nicht geltend gemacht werden könnten. Für den modernen Rechtsstaat wäre eine derartige Vorstellung abwegig.
Man denke nur an Art. 19 Abs. 4 Bonner GG. In der DDR hält man sie aber nicht für verfehlt.
27 g) Dort gibt es weder eine Verfassungsgerichtsbarkeit (»Uber Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften entscheidet die Volkskammer« - Art. 89 Abs. 3 Satz 2) noch eine Verwaltungsgerichtsbarkeit (s. Rz. 27 zu Art. 5, 10 zu Art. 92). Der Rechtsweg ist nur zulässig in Straf-, Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen, soweit nicht durch Gesetz oder andere Rechtsvorschriften die Zuständigkeit anderer Staatsorgane begründet ist. In anderen Angelegenheiten kann durch Gesetz der Rechtsweg für zulässig erklärt werden [§ 4 Gesetz über die Verfassung der Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik - Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) - v. 27.9.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1974, S. 457)]. Nach ständiger Rechtsprechung ist es auch unzulässig, im Wege der Schadensersatzklage Maßnahmen der öffentlichen Gewalt justizia-bel zu machen (Ottobert L. Brintzinger, Staatshaftung für Amtspflichtverletzungen in der SBZ? mit weiteren Nachweisen). Diese Linie wird nach dem Erlaß der Verfassung von 1968 weiterverfolgt. Ein Beispiel bildet das in Vollzug des Art. 106 a. F. erlassene Staatshaftungsgesetz vom 12.5.1969 [Gesetz zur Regelung der Staatshaftung in der Deutschen Demokratischen Republik - Staatshaftungsgesetz - v. 12.5.1969 (GBl. DDR Ⅰ 1969, S. 34)], das die Anrufung der Gerichte bei Schäden, die einem Bürger oder seinem persönlichen Eigentum durch Mitarbeiter oder Beauftragte staatlicher Organe oder staatlicher Einrichtungen in Ausübung staatlicher Tätigkeit rechtswidrig zugefügt werden, ausschließt (s. Erl. zu Art. 104).
Da es nach § 4 Abs. 1 Satz 2 GVG möglich ist, den Rechtsweg in anderen als den in § 4 Abs. 1 Satz 1 genannten Sachen durch Gesetz für zulässig zu erklären, wäre es freilich möglich, etwa im Wege einer Enumeration, für die Verletzung gewisser Grundrechte den Rechtsweg vor den Gerichten zu eröffnen. Das ist jedoch, bis auf einen praktisch bedeutungslosen Fall, nicht geschehen. (Nach § 27 Abs. 3 und 4 des Wahlgesetzes von 1976 [Gesetz über die Wahlen zu den Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik - Wahlgesetz - v. 24.6.1976 (GBl. DDR Ⅰ 1976, S. 301); zuvor: § 20 Abs. 3 und 4 des Erlasses des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Wahlen zur Volkskammer und zu den örtlichen Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik (Wahlordnung) v. 31.7.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 99) in der Fassung des Erlasses des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Neufassung des Erlasses über die Wahlen zur Volkskammer und zu den örtlichen Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik (Wahlordnung) v. 2.7.1965 (GBl. DDR Ⅰ 1965, S. 144)] ist das Kreisgericht für die Entscheidung über den Einspruch eines Wahlberechtigten gegen seine Streichung aus der Wählerliste zuständig. Die Entscheidung des Kreisgerichts ist endgültig. Ein Fall der Anwendung ist jedoch nicht bekannt.)
Die Frage, ob die Gerichte der DDR als Organe angesehen werden können, die im Falle einer eventuellen Erweiterung der Zulässigkeit des Rechtsweges auf Grundrechtsverletzungen einen Rechtsschutz gewähren könnten, der die sozialistischen Grundrechte zu subjektiven (öffentlichen) Rechten im hergebrachten Sinne machen würde, braucht daher nicht erörtert zu werden. Sie wäre aber zu verneinen. Denn die Gerichte in der DDR sind als Bestandteile der einheitlichen sozialistischen Staatsmacht vor allem mit dem obersten Machtorgan nach dem Prinzip der Gewalteneinheit (s. Rz. 21-32 zu Art. 5) untrennbar verbunden (s. Erl. zu Art. 90), nicht Organe, die mit allen Attributen der Unabhängigkeit ausgestattet sind. Es fehlt also auch dann eine unabdingbare Voraussetzung des subjektiven (öffentlichen) Rechts.
Rechtsentwicklung bis zur Wende im Herbst 1989: Durch das Gesetz über die Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte zur Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen [v. 14.11.1988 (GBl. DDR I 1988, S. 327)] wurde einige Monate vor der Wende mit Wirkung vom 1.7.1989 an die Kompetenz der Gerichte, in derartigen Sachen über die Zuständigkeit, über Einsprüche gegen die Streichung von der Wählerliste zu entscheiden, hinaus erweitert. Gleichzeitig trat die VO zur Anpassung von Regelungen über Rechtsmittel der Bürger und zur Festlegung der gerichtlichen Zuständigkeit für die Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen [v. 14.12.1988 (GBl. DDR I 1988, S. 330)] in Kraft. Damit wurde zwar die in einigen Ländern der DDR zunächst vorhandene, aber 1952 abgeschaffte Verwaltungsgerichtsbarkeit entgegen einiger Stimmen in der Rechtswissenschaft der DDR nicht wieder eingeführt. Statt dessen wurde von der in der Vorauflage (s. Rz. 27 zu Art. 19) erwähnten Möglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Verfassung der Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik - Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) - v. 27.9.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1974, S. 457) Gebrauch gemacht, den Rechtsweg auch für Rechtsverletzungen durch die staatliche Gewalt im Wege der Enumeration zu eröffnen. Gerichtlicher Rechtsschutz war danach außer in den schon bisher zulässigen Fällen (s. Rz. 10 zu Art. 92) in einer Reihe von weiteren Fällen zu gewähren. Wegen des Mangels an Unabhängigkeit der Gerichte als Organe der einheitlichen Staatsmacht der DDR ist auch dieser bescheidene Rechtsschutz gegen Verwaltungsakte als unzureichend anzusehen, wie schon in der Vorauflage (s. Rz. 27 zu Art. 19) für den Fall der Ausnützung der Möglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 GVG ausgeführt. Wenn auch durch die überraschend eingeführte Neuregelung dem im Sommer 1989 immer stärker werdenden inneren Druck auf die unter der Suprematie der SED stehenden Staatsorgane ein Ventil geöffnet werden sollte, konnte so die Wende im Herbst nicht aufgehalten werden. Spekulationen darüber, ob damit ein erster Schritt zu einem umfassenden Rechtsschutz in der DDR unternommen war, erwiesen sich damit als müßig (Einzelheiten in ROW 2/1989, S. 109).
28 h) So ist mit Dietrich Müller-Römer dafür zu halten, daß die sozialistischen Grundrechte nicht als subjektive (öffentliche) Rechte im Sinne der hergebrachten Grundrechtsdogmatik betrachtet werden können. Das betont auch das Lehrbuch »Staatsrecht der DDR« (S. 185). Trotzdem erscheint die Verwendung des Begriffs subjektive Rechte in bezug auf die sozialistischen Grundrechte nicht ohne Belang. Es muß nämlich bedacht werden, daß, wenn auch der Rechtsweg vor den Gerichten nicht offensteht, es doch Sicherungen gibt. Es sind diese:
(1) Die Verwaltungsbeschwerde. Sie ist kein generell gegebener Rechtsbehelf, sondern wird in der einfachen Gesetzgebung von Fall zu Fall eröffnet. Über sie entscheidet das Organ, welches dem Organ übergeordnet ist, dem die Verletzung oder Beeinträchtigung eines Rechts vorgeworfen wird. Zur Beschwerde berechtigt ist der Beschwerte. Die Verwaltungsbeschwerde ist nicht an eine Form, jedoch in der Regel an eine Frist gebunden. Sie muß in der Regel auch innerhalb einer Frist erledigt werden [Einzelheiten ab 1.7.1971: Gesetz über die Neufassung von Regelungen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen staatlicher Organe v. 24.6.1971 (GBl. DDR I 1971, S. 49); Verordnung dazu v. 24.6.1971 (GBl. DDR II 1971, S. 465; Ber. GBl. DDR II 1971, S. 544); Anordnungen dazu v. 28.7.1971 (GBl. DDR II 1971, S. 539), 3.8.1971 (GBl. DDR II 1971, S. 545) und v. 13.8.1971 (GBl. DDR II 1971, S. 574)].
(2) Die Beschwerde nach Art. 103 und dem zur Ausführung dienenden Eingabengesetz [Gesetz über die Bearbeitung der Eingaben der Bürger - Eingabengesetz - v. 19.6.1975 (GBl. DDR Ⅰ 1975, S. 461)] (s. Erl. zu Art. 103).
(3) Die Allgemeine Aufsicht der Staatsanwaltschaft und insbesondere deren Befugnis, von Amts wegen Protest bei dem Organ einzulegen, das eine Gesetzesverletzung einschließlich der Verletzung der Verfassung als des »Gesetzes der Gesetze« begangen hat (§§ 29-34 Staatsanwaltschaftsgesetz vom 7.4.1977 [Gesetz über die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen Republik v. 7.4.1977 (GBl. DDR Ⅰ 1977, S. 93] (s. Rz. 24-28 zu Art. 97).
Der Beschwerte ist nicht beschwerdeberechtigt. Er kann sich nur an die Staatsanwaltschaft wenden und dort seine Beschwerde vortragen. Sie wird dann tätig, wenn ihrer Ansicht nach eine Gesetzesverletzung vorliegt.
(4) Die Gerichtskritik, die nach § 19 GVG durch begründeten Beschluß des Gerichts erhoben werden kann, wenn eine Gesetzesverletzung unter anderem auch durch ein Organ der staatlichen Verwaltung im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren festgestellt wird (s. Rz. 24 zu Art. 92). Das Gericht wird von Amts wegen tätig, ohne daß der Beschwerte in irgendeiner Weise, etwa durch Stellung eines Antrages, Einfluß hätte.
Der Protest der Staatsanwaltschaft und die Gerichtsbarkeit sind eindeutig Institute, die ausschließlich die Funktion haben, für die Einhaltung der objektiven Rechtsordnung Sorge zu tragen, indem die Staatsanwaltschaft oder das Gericht auf eine Verletzung hinweist.
Die Entscheidung über die Abhilfe liegt indessen allein bei den Staatsorganen, denen eine Verletzung zur Last gelegt wird. Weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht haben die Befugnis, diese Organe zu einem Tun oder zu einem Unterlassen zu zwingen. Wenn einer Gesetzesverletzung im Wege dieser Verfahren abgeholfen wird, so mag auch ein einem einzelnen verbürgtes Recht durchgesetzt werden, indessen deshalb, weil die objektive Rechtsordnung wiederhergestellt wurde, nicht weil er als Subjekt einen Anspruch durchgesetzt hätte.
Da bei der Verwaltungsbeschwerde und der Beschwerde nach Art. 103 in Verbindung mit dem Eingabengesetz der Beschwerte zur Beschwerde berechtigt ist, erscheint er hier als Subjekt, das eigene Ansprüche geltend macht und nicht nur die Verletzung der objektiven Rechtsordnung rügt. Indessen ist der Wirksamkeit der Verwaltungsbeschwerde insofern eine Grenze gesetzt, als die unteren Organe ohnehin den Intentionen der übergeordneten Organe zu folgen haben, deshalb die Entscheidung der einen in der Regel so ausfal-len wird, wie es die anderen wünschen, diese also im allgemeinen keinen Anlaß haben, jene zu desavouieren.
29 Wenn auch der Rechtsschutz nicht als ausreichend angesehen werden kann, um den sozialistischen Grundrechten den Charakter subjektiver (öffentlicher) Rechte im Sinne der hergebrachten Grundrechtsdogmatik zu geben, so ist doch nicht zu verkennen, daß die sozialistischen Grundrechte mehr sind als nur Reflexe der objektiven Rechtsordnung.
Es fragt sich, ob es in Anbetracht der scharfen Scheidung zwischen dem subjektiven (öffentlichen) Recht und dem Reflex der objektiven Rechtsordnung, wie sie oben entwickelt wurde, noch etwas Drittes gibt. Für einen Staat mit einer umfassenden Rechtsweggarantie ist das zu verneinen. Für ein Gemeinwesen, in dem es diese nicht, indessen andere Sicherungen, wenn auch mit geringerer Wirksamkeit gibt, kann das nicht ohne weiteres verneint werden. Denn es gibt in ihm Ansprüche des einzelnen, die er zwar nicht im Rechtsweg, jedoch anderweitig, wenn auch mit unzulänglichen Mitteln verfolgen kann. Die ihnen zugrunde liegende Position ist nicht nur ein Reflex der objektiven Rechtsordnung, sondern etwas mehr. Dem einzelnen ist eine rechtlich geschützte Position dergestalt verliehen, daß es ihm möglich ist, eine Verletzung oder Beeinträchtigung von bestimmten Organen geltend zu machen. Wenn die Rechtslehre in der DDR diese Position als subjektives Recht bezeichnet, so wird damit angezeigt, daß es sich bei ihr um mehr als nur einen Reflex der objektiven Rechtsordnung handelt. Sie verschafft dem einzelnen eine Stellung in Staat und Gesellschaft, die es ihm ermöglicht, bei einer Verletzung oder Beeinträchtigung selbst initiativ zu werden. Das geschieht unbeschadet der Ptämisse, derzufolge es eine Gegensätzlichkeit zwischen Staat, Gesellschaft und dem einzelnen nicht gibt. Da die Prämisse aber nunmehr nur noch im Grundsatz gelten soll, wird Raum für die Vorstellung geschaffen, daß in mit den Zeitumständen und mit als Rudimente der Vergangenheit erklärten Einzelfällen dem einzelnen gegen die Staatsorgane Schutz zu gewähren ist. Es muß aber Klarheit bestehen darüber, daß es sich bei der Position des einzelnen nicht um ein subjektives (öffentliches) Recht im Sinne der hergebrachten Rechtsdogmatik handelt, weil es dabei bleibt, daß der Bürger eine Initiative zur Geltendmachung eines Grundrechts nicht so gestalten kann, daß durch sie ein mit allen Attributen der Unabhängigkeit ausgestattetes Organ in Bewegung gesetzt werden kann, wie es der Fall bei einer Rechtsordnung ist, die von einem prinzipiellen Gegensatz zwischen dem Staat und dem Bürger ausgeht. So ist diese Position des Bürgers nach wie vor Ausdruck der Einordnung des »vergesellschafteten« Menschen in Staat und Gesellschaft, aber auch das Ergebnis einer gewissen Aufwertung, die die Rolle des Rechts erfahren hat (s. Rz. 56-62 zu Art. 19). Wenn Traute Schönrath (Einheit von Rechten und Pflichten in der sozialistischen Gesellschaft, S. 1717) das subjektive Recht im DDR-Verständnis als »durch die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten in einer Rechtsvorschrift allgemein verbindlich statuierte und damit staatli-cherseits garantierte und geschützte bestimmte mögliche, gesellschaftlich notwendige bzw. zulässige Verhaltensweise von Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft« definiert, so entspricht das dem durchaus. Ingo Wagner (Theoretisches zum subjektiven Recht in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, S. 674) meint, das subjektive Recht sei als »eine qualitativ neue Erscheinung in der sozialistischen Gesellschaftsordnung« unter generell-grundsätzlichem Aspekt bereits »überzeugend und ausreichend« begründet worden, und versucht, die Notwendigkeit dieser spezifischen Kategorie im gezeigten Sinne zu vertiefen.
30 i) Auch für das neue Grundrechtsverständnis der marxistisch-leninistischen Rechtstheorie ist der kybernetische Aspekt(s. Rz. 15-19 zu Art. 2) von Bedeutung, unter dem auch die Stellung des einzelnen in Staat und Gesellschaft betrachtet wird. So schrieben Willi Büchner-Uhder, Eberhard Poppe und Rolf Schüsseler (Grundrechte und Grundpflichten der Bürger der DDR, S. 589), die subjektiven Rechte und in Sonderheit die Grundrechte mit den ihnen immanenten Möglichkeiten für den Bürger, nach eigener Entscheidung in einer bestimmten Weise tätig zu werden und so gleichsam den für ihn und die Gesellschaft günstigsten Weg der Entfaltung der gesellschaftlichen Nutzbarmachung seiner Kräfte einzuschlagen, seien ihrem Grundgehalt nach juristische Organisationsformen der gewissen Selbstregulierung und Optimierung des gesellschaftlichen Handelns der einzelnen Gesellschaftsmitglieder. In diesem Sinne müßten sie begründet, erläutert und wahrgenommen werden.
31 j) Indessen läßt auch die DDR-Literatur keinen Zweifel daran, daß die Probleme des subjektiven Rechts zumindest teilweise offen sind (Traute Schönrath, Einheit von Rechten und Pflichten in der sozialistischen Gesellschaft, S. 1723, Fußnote 18). Die weitere Entwicklung ist abzuwarten. Beachtung verdient eine zur Diskussion gestellte jüngste Äußerung Karl Bönningers (Zu theoretischen Problemen eines Verwaltungsverfahrens und seiner Bedeutung für die Gewährleistung der subjektiven Rechte der Bürger, S. 938), die rechtliche Ordnung des Verfahrens vor den Verwaltungsorganen zur Gewährleistung der subjektiven Rechte der Bürger sei eine gesellschaftliche Aufgabe ersten Ranges. Der Weg von einem künftigen Verwaltungsverfahrensrecht zu einer gerichtlichen Kontrolle der Verwaltung ist aber noch weit.
8. Grundrechte und Grundpflichten gegenüber der Gesellschaftsorganisation - Drittwirkung
32 Nach der Grundrechtskonzeption der marxistisch-leninistischen Lehre betreffen die sozialistischen Grundrechte nicht nur das Verhältnis zwischen Bürger und Staat im Sinne der Staatsorganisation.
33 a) Schon unter den Verhältnissen der Verfassung von 1949 schrieben Eberhard Poppe und Rolf Schüsseler (Sozialistische Grundrechte und Grundpflichten der Bürger, S. 216), die Grundrechte und Grundpflichten beträfen das Verhältnis zwischen Individuum und »Gemeinschaft«, worunter die zur Gemeinschaft erklärte Gesellschaftsorganisation (s. Rz. 29-33 zu Art. 3) zu verstehen ist. Weil indessen die sozialistischen Grundrechte nicht eine Freiheitssphäre des Bürgers von anderen Sphären abgrenzen, wird durch sie auch kein Schutz vor den Eingriffen von Organisationen der Gesellschaft, an ihrer Spitze vor denen der SED geschaffen. Es gibt kein außerhalb dieser Organisationen bestehendes Organ, vor der der einzelne Verletzungen seiner Rechte durch die Organe der organisierten Gesellschaft geltend machen könnte. Vielmehr zeigt sich auch im Verhältnis zur Gesellschaftsorganisation ihre Eigenschaft als verliehene Betätigungsvollmachten, die immanent beschränkt sind. Deren Verleihung ist an die Aufnahme in die Organisation geknüpft. Mit ihr entsteht die korrespondierende Verpflichtung zur Betätigung. Die Ausgestaltung im einzelnen ist den Statuten der Organisationen überlassen. Nur die Nationale Front macht eine Ausnahme. Sie erfaßt die sozialistische Gemeinschaft total und kennt keine Einzelmitgliedschaft (s. Rz. 1-16 zu Art. 3). Daraus ergeben sich für jeden Bürger das Recht und die Pflicht, sich in ihr zu betätigen.
34 b) Auch das Verhältnis der Bürger zueinander muß wegen deren Eingeschlossenheit in die Gesellschaft durch die sozialistischen Grundrechte bestimmt werden. Die Verfassung sagt dazu expressis verbis freilich nichts. Indessen kann aus Art. 19 Abs. 2, wonach Achtung und Schutz der Würde und Freiheit der Persönlichkeit nicht nur Gebot für die staatlichen Organe, sondern auch für alle gesellschaftlichen Kräfte und jeden einzelnen Bürger sind, geschlossen werden, daß die Bürger zur Beachtung der sozialistischen Grundrechte anderer verpflichtet sind. Unter der Geltung der Verfassung von 1949 hatte das OG
(NJ 1959, S. 287) ausgeführt, daß die Betriebe gehalten seien, das Recht auf Arbeit zu beachten. Nun betrifft dieser Fall eigentlich die Verpflichtung einer vom Staat organisierten Einrichtung und konnte sich daher nur auf eine mittelbare Verletzung durch die Staatsorganisation beziehen. Das wäre aber eine falsche Betrachtungsweise; denn der Betrieb wird hier in seiner Eigenschaft als Einheit mit eigener Rechtsfähigkeit [So z. Zt. § 31 Abs. 2 Satz 1 Verordnung über die Kombinate, Kombinatsbetriebe und volkseigenen Betriebe v. 8.11.1979 (GBl. DDR Ⅰ 1979, S. 355)] angesehen, also als »Dritter«. Das OG ist daher so zu verstehen, daß es jeden Dritten, also auch einen Bürger für verpflichtet hält, das Recht auf Arbeit eines (anderen) Bürgers zu beachten. (Wegen des Rechts auf Arbeit im einzelnen s. Erl. zu Art. 24). Mit Dietrich Müller-Römer (Die Grundrechte im neuen mitteldeutschen Verfassungsrecht, S. 314) ist daher dafür zu halten, daß hier eine Drittwirkung der Grundrechte angenommen wurde. Im Schrifttum der DDR wurde die Frage der Drittwirkung nicht behandelt. Sie schien daher keine Probleme aufzugeben, was in Anbetracht der Grundrechtskonzeption nicht verwundern kann (Dietrich Müller-Römer, a.a.O.).
9. Die sozialen Grundrechte
35 Die Einbindung des »vergesellschafteten« Menschen in die sozialistische Gesellschafts- und Staatsordnung hat einen weiteren Aspekt, der sich für ihn positiv auswirken kann. Sie verspricht ihm Schutz vor den Wechselfällen des Lebens und gewährleistet ihm Aufstiegschancen. Normativ kommt er in den sozialen Grundrechten zum Ausdruck, die weit ausgebaut sind (Art. 24 bis 26, 34 bis 37).
Ihre Einordnung in die marxistisch-leninistische Grundrechtskonzeption ist nicht einfach. Sie ist auch in der DDR kaum versucht worden. Der Gedanke des Interesses, dessen Erfüllung die Grundrechte dienen, kann wohl als Brücke dienen. Soweit die sozialen Grundrechte Schutz vor den Wechselfällen des Lebens geben oder nur der Erfüllung von Bedürfnissen dienen, können sie nicht als Betätigungsvollmachten angesehen werden, sondern ihre Verwirklichung schafft allenfalls die Voraussetzung dafür, daß solche faktisch ausgeübt werden können.
Soziale Grundrechte dienen jedoch nicht nur den erwähnten Zwecken, sondern sind auch als Betätigungsvollmachten, verbunden mit korrespondierenden Pflichten, gestaltet. Das gilt zum Beispiel für das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit (Art. 24), sowie das Recht auf Bildung und die Pflicht aller Jugendlichen, einen Beruf zu erlernen (Art. 25 Abs. 1, Abs. 4 Satz 3) (s. Erl. zu Art. 24 und 25).
Im übrigen sind die sozialen Grundrechte als Rechte auf Gewährung von Leistungen durch Staat und Gesellschaft anzusehen. Die Verfassung legt dazu aber nur das Prinzipielle fest. Einzelheiten, die die sozialen Rechte näher ausgestalten, sind der einfachen Gesetzgebung überlassen. Aus ihnen ergeben sich auch die Ansprüche, die zum Beispiel auf dem Gebiet der Arbeit sogar vor den Gerichten verfolgt werden können (s. Erl. zu Art. 92), wobei auf das Grundrecht selbst zurückgegriffen werden kann und auch dessen Drittwirkung zutage tritt (s. Rz. 34 zu Art. 19).
Von den auch in den Verfassungen freiheitlicher Staaten verankerten sozialen Grundrechten unterscheidet sich ihre Konstituierung in der DDR-Verfassung dadurch, daß hier besondere Sorgfalt auf die materiellen Garantien gelegt wird, mit deren Hilfe sie verwirklicht werden sollen und die recht detailliert aufgeführt werden.
Indessen wird auch die soziale Sicherheit durch entsprechende Grundrechte nicht unbeschränkt gewährleistet. Sie sind vielfach an den Vorbehalt des Wohlverhaltens gegenüber der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung geknüpft. Die Sätze von Eberhard Poppe (Der Verfassungsentwurf ..., S. 540) »Die Gesellschaft kann den einzelnen nur schützen, wenn er ihren Bestand schützt und festigt. Sie kann die Ansprüche des einzelnen nur mit den Mitteln befriedigen, die er für den gesellschaftlichen Reichtum mit erarbeitet hat«, die der Begründung für die These von der Einheit von Rechten und Pflichten dienen sollen, müssen für die sozialen Grundrechte so gedeutet werden. Die sozialen Grundrechte werden vom Leistungsprinzip überlagert (Art. 2 Abs. 3 Satz 3, s. Rz. 40 zu Art. 2).
10. Die Grenze der sozialistischen Grundrechtskonzeption
36 Die Konzeption der sozialistischen Grundrechte als Betätigungsvollmachten hat dort ihre Grenze, wo in der Verfassung formulierte Rechte nicht mehr so erklärt werden können, daß die Leitung in der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung die Führungsgrößen setzt. Das gilt vor allem für das Recht des Bürgers, sich zu einem religiösen Glauben zu bekennen und religiöse Handlungen auszuüben (Art. 39). Es handelt sich hier um Gestattungen durch die sozialistische Gesellschafts- und Staatsordnung für Betätigungen, deren Impulse aus einem außerweltlichen Bereich kommen und die auch von der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung, aus welchen Gründen auch immer und auf wie lange Zeit noch, geschützt werden (s. Erl. zu Art. 39). So ist es sinnvoll, wenn Art. 39 am Ende des Kapitels 1 »Grundrechte und Grundpflichten der Bürger« und damit außerhalb der nach marxistisch-leninistischer Lehre konzipierten Grundrechte steht. (Wegen der Gewissens- und Glaubensfreiheit als Ausdruck des Gleichheitssatzes s.
Rz. 15-19 zu Art. 20; wegen der Besonderheiten des Art. 40 s. Erl. dazu).
11. Die Grundrechte - unmittelbar anzuwendendes Recht
37 Die sozialistischen Grundrechte sind unmittelbar anzuwendendes Recht. Art. 105, demzufolge die Verfassung insgesamt unmittelbar geltendes Recht ist, hat für sie besondere Bedeutung. Sie sollen keine »momentan nicht anwendbare Programmnormen« darstellen (Eberhard Poppe, Der Verfassungsentwurf ..., S. 538), unbeschadet der Tatsache, daß einzelne Grundrechte noch nicht durchgängig von allen Bürgern verwirklicht werden können, weil es noch an den notwendigen materiellen Voraussetzungen fehlt (a.a.O., S. 539). Das schließe nicht aus, daß der Grundrechtsteil der Verfassung »das Verhalten der sozialistischen Menschengemeinschaft und der Bürger auf die Vollendung des Sozialismus« orientiere. Damit sei es möglich, daß sie »der Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung im Sozialismus entsprechend durch die Bürger weiter entfaltet, in ihrem Inhalt und so auch in ihren Garantien reicher ausgestaltet« werden könnten. Eberhard Poppe hält es für möglich, daß der Grundrechtsteil künftig noch um weitere Grundrechte bereichert werden wird (a.a.O. S. 539).
12. Verzicht auf Grundrechte?
38 Die Frage, ob auf ein sozialistisches Grundrecht verzichtet werden kann, wurde, soweit übersehbar, in der DDR bisher nicht näher untersucht. In Art. 22 Abs. 3 wird von unverzichtbaren sozialistischen Wahlprinzipien gesprochen. Wenn damit auch nicht das Wahlrecht als unverzichtbar bezeichnet wird, so stehen doch diese Wahlprinzipien in einem so engen Zusammenhang mit ihm (s. Rz. 26-30 zu Art. 22), daß auch das Wahlrecht in seiner spezifischen Ausgestaltung als unverzichtbar angesehen werden muß. Aus der marxistisch-leninistischen Grundrechtskonzeption ist zu schließen, daß die Unverzichtbarkeit der sozialistischen Grundrechte allgemein gilt. Denn diese ist nach ihr eine Konsequenz aus der Stellung des einzelnen in der sozialistischen Gesellschaft, die nicht zu seiner Disposition steht. Kennzeichnend dafür ist, daß ein Verzicht auf die Staatsbürgerschaft nicht möglich ist (s. Rz. 92 zu Art. 19), weil sie die Position des einzelnen in der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung bestimmt (s. Rz. 79 zu Art. 19).
Indessen wird der Verzicht auf die Ausübung eines Grundrechts für zulässig erachtet. Aktuell ist die Frage des Verzichts auf Ausübung beim Wahlrecht in bezug auf die Geheimhaltung der Wahlentscheidung (s. Rz. 35 zu Art. 22) sowie auf die Wahrung des Post- und Fernmeldegeheimnisses (s. Rz. 16 zu Art. 31). Es zeigt sich hier die Fragwürdigkeit der auf der Begriffsjurisprudenz beruhenden Unterscheidung zwischen dem Verzicht auf ein Grundrecht und dem Verzicht auf seine Ausübung. Denn sozialer Druck kann den Verzicht auf die Ausübung erzwingen. Das Grundrecht läuft dann leer, obwohl von ihm behauptet werden kann, daß es in seiner Geltung nicht angetastet ist. (Wegen des Gleichheitssatzes in der Grundrechtskonzeption s. Rz. 1-14 zu Art. 20.)
13. Weitere »Grundrechtsarbeit«
39 Auf einer Konferenz der Staats- und Rechtswissenschaft im November 1980 beschäftigte sich auch eine Arbeitsgruppe mit Grundrechtsfragen. Beim Abschluß des Manuskripts waren Ergebnisse noch nicht veröffentlicht worden. Eberhard Poppe (Aufgaben und Probleme der Grundrechtsarbeit) hatte indessen dazu schon vorher Anregungen gegeben. Dabei stellte er u. a. folgende Überlegungen an: Es entspreche dem Humanismus der sozialistischen Gesellschaft, daß sich die kollektive Ausübung von Grundrechten und -pflichten weiter auspräge und diese dadurch zusätzliche Förderung erführen. Ferner gelte es, die Subjektivität sozialistischer Grundrechte als die in den Grundrechten liegende Möglichkeit zu verstehen, dem Bürger bewußt zu machen, daß die sozialistische Rechtsordnung der Verwirklichung und dem Schutz seiner Rechte und legitimen Ansprüche diene. Beeinträchtigungen und Verletzungen von Rechten oder Pflichten durch Bürger müsse durch Ausbau der Kontrolle schneller und wirksamer begegnet werden. An den methodischen und terminologischen Klärungen gelte es weiterzuarbeiten, z. B. an der Systematisierung der Grundrechte und ihrer Garantien sowie am Fachvokabular.

III. Sozialistische Grundrechte und Menschenrechte
40 Da die sozialistischen Grundrechte als Bürgerrechte so konzipiert sind, daß sie als konträr zu den »bürgerlichen« Grundrechten angesehen werden, ist die Frage ihrer Übereinstimmung mit den Menschenrechten heikel.
1. Verhältnis zur »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« von 1948
41 Schon über das Verhältnis der sozialistischen Grundrechte zur »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« der Vereinten Nationen vom 10.12.1948 gab es unterschiedliche Auffassungen. Willi Büchner-Uhder und Eberhard Poppe (Die weitere Entfaltung der Grundrechte der Bürger im Kampf um die Sicherung des Friedens durch die Stärkung der ökonomischen Grundlagen der DDR, S. 1053) stellten einen Einklang fest. Insbesondere Eberhard Poppe hob diesen Aspekt in der vor allem für das Ausland bestimmten Zeitschrift »Deutsche Außenpolitik« hervor (Die Menschenrechtsdeklaration der UN in der Verfassungswirklichkeit der DDR; Die DDR und die Menschenrechte). Hermann Klenner (Studien über die Grundrechte, S. 52/53) meinte dagegen, der notwendige Zusammenhang zwischen der sozialistischen Gesellschaft und den sozialistischen Grundrechten werde mystifiziert, wenn einzelne dieser Rechte als sozialistische Anwendung der UN-Menschenrechtserklärung gedeutet würden. Eberhard Poppe wandte eine Methode an, die später Schule machen sollte; Er interpretierte die Menschenrechtsdeklaration im marxistisch-leninistischen Sinne, während Hermann Klenner damals noch davor zurückschreckte, ihm, was die darin enthaltenen Freiheitsrechte anbetrifft, zu folgen.
2. Verhältnis zu den UN-Menschenrechtskonventionen
42 Die DDR gehört zu den Teilnehmerstaaten der Internationalen Konvention über zivile und politische Rechte vom 16.12.1966 [Bekanntmachung über die Ratifikation der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über zivile und politische Rechte v. 14.1.1974 (GBl. DDR II 1974, S. 57); Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über zivile und politische Rechte vom 1. März 1976 (GBl. DDR ⅠⅠ 1976, S. 108)] (politische Konvention) und der Internationalen Konvention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 16.12.1966 [Bekanntmachung über die Ratifikation der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte v. 14.1.1974 (GBl. DDR II 1974, S. 105); Bekanntmachung über die Ratifikation der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte v. 21.11.1975 (GBl. DDR II 1975, S. 266)] (soziale Konvention). Die Bedeutung der Konventionen liegt darin, daß sich mit ihnen Staaten mit unterschiedlichen Konzeptionen über die Menschenrechte auf einen gemeinsamen Text geeinigt hatten. Das wird auch in der DDR anerkannt. So schrieb Hans Gruber (Zum UNO-Menschenrechtstag 1976, S. 1811/1812), in den Konventionen würden die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 aufgestellten unverbindlichen Grundsätze präzisiert, komplettiert und entsprechend dem sich zugunsten der Kräfte des Friedens und des Sozialismus veränderten internationalen Kräfteverhältnis weiterentwickelt und mit Rechtskraft ausgestattet. Wenn der Autor anschließend den Kompromißcharakter der Konventionen hervorhebt, der aus marxistisch-leninistischer Sicht zu Mängeln führe, so wird die Einigung auf den gemeinsamen verbindlichen Text verdeutlicht. Die politische Konvention ist deshalb von aktueller Bedeutung, weil die Staaten sich in ihr verpflichten, gesetzgeberische und andere Maßnahmen zu treffen, um ihr innerstaatliches Recht in Einklang mit der Konvention zu bringen (Art. 2 Abs. 1 a.a.O.), während nach der sozialen Konvention jeder Teilnehmerstaat nur verpflichtet ist, einzeln sowie durch internationale Hilfe und Zusammenarbeit, insbesondere auf wirtschaftlichem und technischem Gebiet, mit allen zur Verfügung stehenden Kräften Schritte zu unternehmen, um nach und nach die volle Verwirklichung der in der Konvention anerkannten Rechte mit allen geeigneten Mitteln, vornehmlich gesetzgeberischen Maßnahmen, zu erreichen (Art. 2 Abs. 1 a.a.O.). Ferner sind nach Art. 40 der politischen Konvention die Teilnehmerstaaten verpflichtet, Berichte über die von ihnen getroffenen Maßnahmen zur Verwirklichung der hierin anerkannten Rechte und über die bei der Wahrnehmung jener Rechte erzielten Fortschritte dem Menschenrechtskomitee der UN zu übermitteln.
Die DDR ist dieser Verpflichtung durch ihren »Initial Report« vom 28. 6. 1977 (CCPR/C 1 Add. 13 vom 7. 7. 1977) nachgekommen. Ein Vertreter der DDR ergänzte den Bericht mündlich auf einer Tagung des Menschenrechtskomitees am 28.1.1978 in Genf und stellte sich einer Befragung (CCPR/C/SR.65) [Ende Januar tagte im Genfer Sitz der Vereinten Nationen das Menschenrechtskomitee, Interview (NJ DDR 1978, S. 207)].
Die politische Konvention enthält einige Grundrechte, die in der Verfassung von 1968/ 1974 nicht enthalten sind. Es handelt sich dabei um
- das Auswanderungsrecht (Art. 12 Abs. 2 a.a.O.)
- das Recht auf freie Information (Art. 19 Abs. 2 Satz 2 a.a.O.)
- das Recht auf Schutz der Intimsphäre, das über das Recht auf Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Art. 30 Verfassung von 1968/1974 hinausgeht, darunter vor allem das nicht in dieser Verfassung enthaltene Recht auf Schutz des Briefgeheimnisses (Art. 17 Abs. 1 a.a.O.).
Es stellte sich jedoch bald im Zuge einer publizistisch geführten West-Ost-Diskussion über die Menschenrechte heraus, daß die Einigung über den Text nicht die Verständigungsschwierigkeiten beseitigen konnte. Ursächlich dafür sind:
43 a) Die DDR bestreitet trotz der Ratifikation die innerstaatliche Wirksamkeit der politischen Konvention und meint, sie wäre nur völkerrechtlich an diese gebunden (vor allem: Bernhard Graefrath, Zu internationalen Aspekten der Menschenrechtsdiskussion, S. 331). Damit verneint sie in Verteidigung des Schießbefehls (s. Rz. 11 zu Art. 7) vor allem die Geltung des Auswanderungsrechts (vor allem: Erich Buchholz/Günther Wieland, Der Fall Weinhold - eine Kette von Rechtsbrüchen der BRD-Justiz, S. 22, unter Berufung auf den West-Berliner Rechtswissenschaftler Herwig Roggemann, Grenzübertritt und Strafrechtsanwendung zwischen beiden deutschen Staaten, S. 247). Die Auffassung, durch Ratifikation eines völkerrechtlichen Vertrages trete keine Transformation in innerstaatliches Recht ein, muß als Schutzbehauptung gewertet werden. Denn die Praxis der DDR sieht im übrigen anders aus. Im Lehrbuch »Staatsrecht der DDR« (S. 228) heißt es: »Die einstimmig beschlossenen Menschenrechtskonventionen sind schließlich auch deshalb ein Fortschritt gegenüber der Deklaration von 1948, weil sie innerstaatlich verbindliches Recht für alle Staaten werden können. Mit diesen Wirkungsrichtungen der beiden UNO- Konventionen stimmt der Inhalt der Verfassung der DDR und der Grundrechte überein. Die Verfassungswirklichkeit ist von den dort verankerten humanistischen Maximen geprägt.« Wenn das heißen soll, die Menschenrechtskonventionen brauchten deshalb keine innerstaatliche Wirkung zu entfalten, weil ihr Inhalt ohnehin in der DDR formell gilt und praktiziert wird, so steht das im Widerspruch zur hier getroffenen Feststellung, derzufolge der Inhalt der politischen Konvention in den genannten drei Bereichen über den Inhalt der formellen Verfassung von 1968/1974 hinausgeht. Das Lehrbuch (S. 229) rühmt zwar, daß die »Bedingungen des realen Sozialismus« sowohl reale Grundrechte und -freiheiten der Bürger hervorbrächten, die den Menschenrechten des Völkerrechts entsprächen, als auch weitergehende Rechte und neue Garantieformen wirklicher menschlicher Freiheit und Selbstverwirklichung, die in den Menschenrechten des Völkerrechts heute noch nicht verankert seien. Aber es schweigt zur Rechtslage, die durch das Zurückbleiben der formellen Rechtsverfassung der DDR in den genannten drei Bereichen entstanden ist. Zu fragen ist zunächst nach den Wirkungen, die nach DDR-Ansicht die Ratifikation eines völkerrechtlichen Vertrages hat. Dazu heißt es im Lehrbuch »Staatsrecht der DDR« (S. 343): »Die Ratifizierung eines völkerrechtlichen Vertrages bedeutet, daß der durch die Verfassung dazu allein legitimierte Staatsrat dem Vertrag zustimmt. Mit der Unterzeichnung durch den Vorsitzenden des Staatsrates wird dokumentiert, daß die DDR die mit dem Vertrag übernommenen Verpflichtungen gewissenhaft erfüllen wie auch die ihr zustehenden Rechte in Anspruch nehmen wird.« An anderer Stelle des Lehrbuches (S. 497/498) heißt es: »Bestimmte völkerrechtliche Verträge bedürfen der Ratifikation durch den Staatsrat, um als innerstaatliches (Unterstreichung vom Verfasser) Recht Gültigkeit zu erlangen.« Das gilt auch für die Ratifikation der beiden Menschenrechtskonventionen durch den Vorsitzenden des Staatsrates am 2.11.1973 [Bekanntmachung über die Ratifikation der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über zivile und politische Rechte v. 14.1.1974 (GBl. DDR II 1974, S. 57); Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über zivile und politische Rechte vom 1. März 1976 (GBl. DDR ⅠⅠ 1976, S. 108)] (politische Konvention) und der Internationalen Konvention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 16.12.1966 [Bekanntmachung über die Ratifikation der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte v. 14.1.1974 (GBl. DDR II 1974, S. 105); Bekanntmachung über die Ratifikation der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte v. 21.11.1975 (GBl. DDR II 1975, S. 266); Ende Januar tagte im Genfer Sitz der Vereinten Nationen das Menschenrechtskomitee, Interview (NJ DDR 1978, S. 207)], wie sie nach der damals geltenden Regelung (s. Rz. 39 zu Art. 66) vorgeschrieben war.
Die innerstaatliche Wirksamkeit beider Konventionen läßt sich auch aus Art. 8 Abs. 1 herleiten, demzufolge die allgemein anerkannten, dem Frieden und der friedlichen Zusammenarbeit der Völker dienenden Regeln des Völkerrechts für die Staatsmacht und jeden Bürger verbindlich sind. Erforderlich ist lediglich ein bestimmter Grad der Konkretisierung. Dieser liegt hinsichtlich der beiden Menschenrechtskonventionen vor (s. Rz. 5 zu Art. 8). Es ist also die Auffassung vertretbar, daß auch ohne eine Ratifikation die Menschenrechtskonventionen aufgrund des Art. 8 Abs. 1 innerstaatlich bindend sind. Dann hätte die Ratifikation der beiden Konventionen nur noch bestätigenden Charakter gehabt.
Andernfalls müßte aber im Lichte des Art. 8 Abs. 1 deren Ratifikation zu einer innerstaatlichen Wirkung fuhren. Diese erstreckt sich auf alle ihre Bestimmungen, also auch auf solche in Bereichen, die von der formellen Rechtsverfassung der DDR nicht erfaßt sind. Wegen ihrer Bedeutung sind somit die Grundrechte der politischen Konvention, die im formellen Verfassungsrecht der DDR nicht enthalten sind, zum Bestandteil ihrer materiellen Rechtsverfassung geworden (Siegfried Mampel, Zum Vergleich - die Verfassungsreform in der DDR, S. 375).
Mangels einer unabhängigen Instanz in der DDR, die über verfassungsrechtliche Zweifelsfragen verbindlich entscheiden könnte, muß die Frage der innerstaatlichen Wirksamkeit der Beantwortung durch die Wissenschaft überlassen bleiben, und zwar der außerhalb der DDR, weil die Rechtswissenschaft der DDR sich zu dieser heiklen Frage nicht frei äußern kann.
Das ist nicht nur von theoretischer, sondern auch von praktischer Bedeutung, wenn etwa von einem Gericht in der Bundesrepublik Deutschland über die Rechtmäßigkeit des Verlassens der DDR und damit über die Unrechtmäßigkeit ihrer Verhinderung durch Anwendung physischer Gewalt entschieden werden muß.
44 b) Die angebliche Übereinstimmung der politischen Konvention mit der formellen Rechtsverfassung der DDR ergibt sich daraus, daß sie im Sinne der marxistisch-leninistischen Grundrechtskonzeption interpretiert wird (so vor allem Hermann Klenner, Menschenrechte im Klassenkampf; Menschenrechte - Heuchelei und Wahrheit; Menschenrechte - Klassenrechte; Menschenrechte und Völkerrecht; aber auch Angelika Zschiedrich, Menschenrechte sind Klassenrechte, u. a.). Das führt dazu, daß die DDR meint, ihre Gesetzgebung und Praxis ständen mit der politischen Konvention in Einklang. Das kam vor allem im »Initial Report« der DDR an die Menschenrechtskommission der UN zum Ausdruck. Darin wurde sogar berichtet, daß die DDR in Befolgung des Art. 2 Abs. 2 der politischen Konvention mit Rücksicht auf Art. 8 a.a.O. (u. a. Verbot der Zwangsarbeit) u. a. durch Wegfall des § 42 StGB mit dem Zweiten Strafrechtsänderungsgesetz vom 7.4.1977 [Gesetz zur Änderung und Ergänzung straf- und strafverfahrensrechtlicher Bestimmungen (2. Strafrechtsänderungsgesetz) v. 7.4.1977 (GBl. DDR Ⅰ 1977, S. 100)] die Arbeitserziehung als Strafe beseitigt hat.
In Wirklichkeit stehen zahlreiche Bestimmungen des einfachen Gesetzesrechts im Gegensatz zur politischen Konvention. Ursächlich ist dafür vor allem, daß die DDR ihre einfache Gesetzgebung so gestaltet hat, daß sie mit der Rechtsfigur des Erlaubnisvorbehalts arbeitet. Sie schränkt die Grundrechte, was in den verfassungsrechtlich vorgesehenen Fällen erlaubt ist und mit der politischen Konvention im Einklang steht, so ein, daß sie grundsätzlich die grundrechtlich zulässige Betätigung verbietet und sie von einer Erlaubnis im Einzelfalle abhängig macht, anstatt daß sie sich vorbehält, im Einzelfalle aus legitimen Gründen, worunter auch Sicherheitsinteressen gehören können, eine Betätigung zu untersagen. Das gilt vor allem für die Meinungsfreiheit (s. Rz. 16 zu Art. 27), das Vereinigungsrecht (s. Rz. 10-20 zu Art. 28) und das Versammlungsrecht (s. Rz. 13, 14 zu Art. 29) (dazu im einzelnen Siegfried Mampel, Bemerkungen zum Bericht der DDR an das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen).
3. Verhältnis zur KSZE-Schlußakte
45 Die DDR gehört zu den Unterzeichnern der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) vom 1.8.1975. In Abschnitt VII des Prinzipienkataloges versprechen die Teilnehmerstaaten die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens- und Religions- oder Überzeugungsfreiheit.
Menschenrechtliche Fragen bilden auch den Gegenstand des sogenannten Korb III (Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen). Obwohl die KSZE-Schlußakte kein völkerrechtliches Abkommen ist (Jens Hacker, Die allgemeinen Menschenrechte in den UN-Menschenrechts-Konventionen und in der KSZE-Schlußakte, S. 91), fühlt sich die DDR an sie gebunden (s. Rz. 4 zu Art. 8). Da die KSZE-Schlußakte im Abschnitt VII des Prinzipienkataloges auf die Internationalen Menschenrechtskonventionen verweist, ist eine besondere Untersuchung des Verhältnisses der sozialistischen Grundrechtskonzeption zu den menschenrechtlichen Partien der KSZE-Schlußakte nicht erforderlich.

IV. Sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit
1. Die Garantie
46 Zwischen den Verfassungsaufträgen zur Wahrung der sozialistischen Gesetzlichkeit und der Rechtssicherheit in Art. 19 Abs. 1 Satz 2 und zur Garantie der Ausübung der Bürgerrechte in Art. 19 Abs. 1 Satz 1 besteht ein innerer Zusammenhang. Denn die sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit werden zu den generellen Garantien für die Ausübung der Bürgerrechte gezählt (s. Rz. 25 zu Art. 19).
Die sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit sollen durch die »Deutsche Demokratische Republik« gewährleistet sein. Die Garantiepflicht trifft alle ihre Organe, d. h. sowohl die zentralen als auch die örtlichen und die von Staatsorganen gebildeten Betriebe und Einrichtungen, insbesondere aber die Gerichte.
2. Begriff der Gesetzlichkeit
47 Die sozialistische Gesetzlichkeit ist ein Grundbegriff der marxistisch-leninistischen Rechtslehre. Der 1962 erschienene dritte Band von »Meyers Neues Lexikon« erläutert den Begriff der Gesetzlichkeit, der in der nicht-marxistisch-leninistischen Rechtslehre kaum gebräuchlich ist, mit der Bindung aller Staatsorgane, gesellschaftlichen Organisationen und Bürger an die Gesetze und anderen Rechtsnormen. Die Gesetzlichkeit diene der Aufrechterhaltung der Macht der herrschenden Klasse und der Durchsetzung ihres Willens. Das Lexikon unterscheidet sodann zwischen der »bürgerlichen« und der »sozialistischen Gesetzlichkeit«. Die bürgerliche Gesetzlichkeit verankere das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln und damit die Ausbeutung der Werktätigen und die politische Macht der Bourgeoisie. Im imperialistischen Stadium des Kapitalismus gebe die monopolkapitalistische Bourgeoisie die Bindung der Staatsorgane an die Gesetze mehr und mehr auf und gehe zur Willkürherrschaft über (Auflösung der bürgerlichen Gesetzlichkeit). Sozialistische Gesetzlichkeit sei dagegen der Ausdruck der Arbeiter-und-Bauern-Macht und habe die strikte Einhaltung der Gesetze und anderen Rechtsnormen durch alle Staatsorgane, gesellschaftliche Organisationen und Bürger zum Inhalt; sie sei eine wichtige Voraussetzung für den Sieg des Sozialismus, da das sozialistische Recht die objektiven Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Entwicklung der Gesellschaft zum Ausdruck bringe. Wenn diese Definition auch in einem populärwissenschaftlichen Werk gegeben wird, so spiegelt sie doch das wider, was zur Zeit in der DDR von Recht und Gesetzlichkeit gehalten wird.
3. Wesen und Funktionen des Rechts
48 Die marxistisch-leninistische Auffassung vom Wesen und von den Funktionen des Rechts wurzelt im dialektischen und historischen Materialismus. Von A. J. Wyschinski (Fragen des Rechts und des Staates bei Marx, S. 76) stammt die Definition: »Das Recht ist die Gesamtheit der Verhaltensregeln, die den Willen der herrschenden Klasse ausdrücken und auf gesetzgeberischem Wege festgelegt sind, sowie die Gebräuche und Regeln des Gemeinschaftslebens, die von der Staatsgewalt sanktioniert sind. Die Anwendung dieser Regeln wird durch die Zwangsgewalt des Staates gewährleistet zwecks Sicherung, Festigung und Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse und Zustände, die der herrschenden Klasse genehm und vorteilhaft sind.« Diese Definition beruhte auf Prämissen, die den Kern der marxistisch-leninistischen Rechtstheorie bilden und niemals in Zweifel gezogen wurden. Indessen stieß diese Definition in der Nach-Stalin-Zeit auf Kritik. Eine allgemein anerkannte Definition ist bis heute nicht gefunden worden. Das DDR-Lehrbuch »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie» (S. 87/88) macht dazu einen Vorschlag, der die in der DDR herrschende Lehre wiedergibt. Danach sind die Eigenschaften des Rechts, unabhängig vom Charakter der
49 Herrschaftsverhältnisse: »
a) Recht ist Staatswille der herrschenden Klasse, dessen Inhalt in ihren materiellen Lebensbedingungen letztlich gegeben sind. Recht ist nicht die Summe individueller Willen von Vertretern der herrschenden Klasse oder ihrer einzelnen Organisationen. Der auf der Grundlage gemeinschaftlicher Interessen der herrschenden Klasse entstehende Wille dieser Klasse muß durch den Klassenwillen hindurchgehen, um allgemeinverbindlich zu werden. Nicht der Staat schafft den Willen der herrschenden Klasse, der im Recht ausgedrückt wird, sondern verleiht ihm rechtlichen Charakter.
b) Der im Recht ausgedrückte Wille der herrschenden Klasse wird zu einem System von Normen erhoben. Die im Recht enthaltenen Verhaltensforderungen sind nicht individuelle Anweisungen, sondern tragen allgemeinen Charakter. Die Normen des Rechts stehen nicht zusammenhangslos nebeneinander, sondern bilden ein System.
c) Recht ist allgemeinverbindlich. Die in Rechtsnormen enthaltenen Verhaltensforderungen sind keine Ratschläge oder Wünsche, die zu beachten sind oder unberücksichtigt gelassen werden können, sondern obligatorische Verhaltensforderungen des Staates.
d) Die Verwirklichung des Rechts wird vom Staat, aber auch von gesellschaftlichen Organisationen der herrschenden Klasse gewährleistet. Die Maßnahmen, die der Staat trifft, um die Verwirklichung des Rechts zu gewährleisten, sind vielfältig und können ideologischer, physisch-zwangsmäßiger und ökonomischer Natur sein.
e) Recht wirkt auf gesellschaftliche Verhältnisse ein. Diese Einwirkung geschieht im Interesse der Klasse und ist klassenmäßig zielgerichtet; Recht ist ein staatlicher Regulator gesellschaftlicher Verhältnisse.«
Damit gelangt das Lehrbuch zu folgender Definition des Rechts: »Recht ist Staatswille der herrschenden Klasse, dessen Inhalt letztlich von deren materiellen Lebensbedingungen determiniert wird, in einem System allgemeinverbindlicher Normen ausgedrückt ist, der Einwirkung auf gesellschaftliche Verhältnisse dient und dessen Verwirklichung vom Staat unter Anwendung von Zwang gewährleistet wird.«
Wegen der tiefgreifenden Unterschiede in den Herrschaftsverhältnissen und den Eigentumsverhältnissen zwischen der freiheitlich-demokratischen Ordnung und der sozialistischen Ordnung unterscheidet sich das Recht der einen Ordnung von dem der anderen grundlegend.
Wegen der totalen Abhängigkeit des Rechts vom Staat mußte der Wandel in den staatstheoretischen Auffassungen des Marxismus-Leninismus (s. Rz. 1-27 zu Art. 1) auch Korrekturen der Rechtstheorie zur Folge haben.
50 Nach dem genannten Lehrbuch (S. 358) gibt es in der marxistisch-leninistischen Rechtstheorie über die Definition des sozialistischen Rechts verschiedene Standpunkte, die aber nur in Nuancen voneinander abweichen und auf die deshalb hier nicht einzugehen ist. Das genannte Lehrbuch faßt seine Auffassung in folgenden Thesen (S. 356) zusammen: »
a) Das sozialistische Recht ist in der Etappe der Diktatur des Proletariats Willensausdruck der Arbeiterklasse, die von ihrer marxistisch-leninistischen Partei geführt wird und im Bündnis mit den werktätigen Bauern beziehungsweise der Klasse der Genossenschaftsbauern sowie anderer Schichten die Macht ausübt. In der Etappe des Staates des ganzen Volkes ist das Recht Willensausdruck des von der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei geführten ganzen Volkes. Der Inhalt des im Recht ausgedrückten Willens ist letztlich in den jeweiligen materiellen Lebensbedingungen der Klassen und Schichten, die Träger der sozialistischen Staatsmacht sind, begründet.
b) Das sozialistische Recht drückt mit zunehmender Exaktheit die Erfordernisse für die Ausnutzung der objektiven gesellschaftlichen Gesetze aus. Es ist ein wichtiges politisch-staatliches Instrument der planmäßigen Gestaltung der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft.
c) Das sozialistische Recht verankert die sozialistischen und kommunistischen Errungenschaften.
Es sichert die sozialistischen und kommunistischen Gesellschaftsverhältnisse in allen Lebensbereichen und schützt deren Entwicklung.
d) Das sozialistische Recht ist Ausdruck und Instrument einer bewußt organisierten Gesellschaft. Es dient der Entwicklung der bewußten Disziplin und des Verantwortungsbewußtseins der Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft.
e) Das sozialistische Recht ist ein System allgemeinverbindlicher Verhaltensregeln (Normen), die vom sozialistischen Staat festgelegt oder sanktioniert sind und deren Verwirklichung durch die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung gewährleistet wird.«
Damit gelangt das Lehrbuch zu folgender Definition des sozialistischen Rechts: »Das sozialistische Recht ist das System allgemeinverbindlicher Normen, die den letztlich von den sozialistischen Produktionsverhältnissen bestimmten staatlichen Willen der Arbeiterklasse und der von ihr geführten Werktätigen ausdrücken, vom Staat festgelegt oder sanktioniert und garantiert werden — wenn nötig auch mit staatlichem Zwang - und als Instrument (Regulator) die Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus fördern und schützen.«
51 Die starke Betonung der Rolle der marxistisch-leninistischen Partei indiziert das Postulat einer Eigenschaft des sozialistischen Rechts, die sie vor allem vom »bürgerlichen« Recht unterscheidet. Das sozialistische Recht wird bewußt »parteilich« gestaltet, auch wenn im Lehrbuch »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie« anstelle dieses Begriffes die Wendung »klassenmäßig zielgerichtet« verwendet wird. Nach marxistisch-leninistischer Rechtstheorie ist zwar jedes Recht parteilich. So schrieb Hermann Klenner (Der Marxismus-Leninismus über das Wesen des Rechts, S. 40), Rechtsnormen wirkten stets im Interesse dieser oder jener Klasse, seien von Natur aus von ihrer Funktion und Aufgabe her parteilich. Das gelte von den Normen der Ausbeuter wie von den Normen der Arbeiter. Aber auch die marxistisch-leninistische Rechtstheorie kann nicht umhin einzuräumen, daß im »bürgerlichen« Recht sich die Interessen der herrschenden Klasse der Kapitalisten nicht rein durchsetzen können. Es wird gesehen, daß sie genötigt sind, auch die Interessen, und seien es auch nur die sogenannten »Tagesinteressen« der Arbeiterklasse in der Gesetzgebung zu berücksichtigen. Die Parteilichkeit des »bürgerlichen« Rechts kann also auch nach marxistisch-leninistischer Lehre, besonders nachdem die Arbeitnehmer sich in den Gewerkschaften eine Organisation zur Interessenvertretung geschaffen haben, nicht mehr rein sein. Die Parteilichkeit des sozialistischen Rechts ist dagegen rein, weil dieses allein Willensausdruck der Arbeiterklasse und der anderen Werktätigen ist - in kritischer Sicht freilich den Willen der marxistisch-leninistischen Partei, in der DDR also den der SED - ausdrückt.
Weil das Recht als ein Produkt des Staates angesehen wird, werden ihm grundsätzlich dieselben Funktionen zugeschrieben wie dem Staat (s. Rz. 10ff. zu Art. 4). Über den Stellenwert der Funktionen des Rechts änderten sich die Auffassungen entsprechend der Wandlung in den Ansichten über den Stellenwert der Staatsfunktionen. Im Jahre 1968 nannte Walter Ulbricht (Die Rolle des sozialistischen Staates ..., S. 1755) an erster Stelle die Funktion des Rechts bei der Organisierung der sozialistischen Gesellschaftsordnung, sodann die erzieherische Funktion des Rechts und ließ darauf erst die Schutz- und Repressionsfunktion folgen. Die Rolle des Rechts als Hebel des Fortschritts trat so vor seine Rolle als Faktor der Bewahrung eines bestehenden Zustandes.
52 Das Lehrbuch »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie« (S. 364) unterscheidet drei Funktionen des Rechts:
a) die fixierend-sichernde Funktion,
b) die organisierend-regulierende Funktion,
c) die schützende Funktion.
In einem Diskussionsbeitrag unterscheidet neuerdings Lothar Lotze (Die Funktionen des sozialistischen Rechts) sechs Funktionen, und zwar
a) die Organisationsfunktion,
b) die Regelungsfunktion,
c) die Direktivfunktion,
d) die Schutzfunktion,
e) die ideologiebildende und Bewertungsfunktion,
f) die Stimulierungsfunktion.
Es handelt sich hier um eine Verfeinerung der Auffassungen des Lehrbuches und gleichzeitig um eine Hervorhebung von Funktionen, die in jüngster Zeit mehr als früher betont werden, insbesondere der ideologiebildenden und der stimulierenden Funktion, die beide im Zusammenhang stehen mit den Bestrebungen, das Rechtsbewußtsein der Bürger zu stärken (s. Rz. 65, 66 zu Art. 19). Aber auch die Nennung der Direktivfunktion als besonderer Funktion ist von Interesse, weil damit die Aufgabe des Rechts, auf die Ziele, die mit den Rechtsnormen erreicht werden sollen, zu orientieren, herausgestellt wird.
4. Begriff der sozialistischen Gesetzlichkeit
53 a) Meinungsstreit vor Erlaß der Verfassung. Die Gewährleistung der sozialistischen Gesetzlichkeit durch die DDR bedeutet also, daß sie für die Bindung an das sozialistische Recht in seinen spezifischen Funktionen zu sorgen hat. Darin liegt insoweit nichts Besonderes, als die Allgemeinverbindlichkeit dem Recht in jeder Gesellschafts- und Staatsordnung wesenseigen ist. In jeder Ordnung kann auch die Frage entstehen, ob die Allgemeinverbindlichkeit auch bei einem Wandel der politischen und sozialen Verhältnisse gilt. In der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung besteht aber die weitere Eigenart, daß der politische und soziale Wandel planmäßig von der führenden Kraft betrieben wird. So taucht hier die Frage auf, ob und inwieweit das Recht noch allgemeinverbindlich bleibt, wenn es den durch einen planmäßigen Wandel geschaffenen Verhältnissen nicht mehr entspricht oder ihm sogar entgegensteht. Darüber hat es Ende der fünfziger Jahre Meinungsverschiedenheiten gegeben, die sich am Begriff der sozialistischen Gesetzlichkeit entzündeten.
Hilde Benjamin (Vom IV. zum V. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands) hatte 1958 den Begriff dahingehend definiert, daß sozialistische Gesetzlichkeit die »dialektische Einheit von strikter Einhaltung der Rechtsnormen und der Parteilichkeit ihrer Anwendung« bedeute. Indessen stieß diese Definition im Juni 1959 auf Kritik. Joseph Leymann und Siegfried Petzold (Zum Wesen der sozialistischen Gesetzlichkeit in der Deutschen Demokratischen Republik) meinten, die schöpferische Rolle der Volksmassen sei in ihr nicht genügend berücksichtigt. Es ging um die Frage, ob die sozialistische Gesetzlichkeit nicht ein Abgehen von der Rechtsnorm dann gebiete, wenn ihre strikte Anwendung den Fortschritt hemme. Sie meinten, sich auf Karl Polak stützen zu können, der in seinen Arbeiten (vor allem: Zur Dialektik in der Staatslehre) dem »Normativismus«, dem »Formalismus« und dem »Positivismus« den Kampf angesagt hatte (Einzelheiten bei Siegfried Mampel, Dialektik und Recht). Die Streitfrage wurde für so schwerwiegend gehalten, daß Ende 1959 sich das 7. Plenum des ZK der SED mit ihr beschäftigte. Darauf zeigte sich Hilde Benjamin (Das 7. Plenum des Zentralkomitees der SED und die Arbeit der Justizorgane) unter Berufung auf das Prinzip des demokratischen Zentralismus als konsequente Verfechterin der Staatsautorität und der Zentralgewalt gegenüber gesellschaftlichen Kräften und untergeordneten Staatsorganen. Sie fand sogar Unterstützung bei Karl Polak (Zur Lage der Rechts- und Staatswissenschaft in der Deutschen Demokratischen Republik), der aber im Gegensatz zur Auffassung von Hilde Benjamin es immer noch für zulässig hielt, daß dann von einer Rechtsnorm abgewichen werden könnte, wenn das von der Führung der marxistisch-leninistischen Partei für notwendig gehalten würde.
54 Das Ergebnis der Diskussion ist den Ausführungen von Gustav Jahn/Siegfried Petzold (Die weitere Entwicklung der sozialistischen Rechtspflege erfordert eine höhere Qualität der Rechtsprechung) zu entnehmen. Sie meinten: »Um das Verhältnis zwischen den Beschlüssen der marxistisch-leninistischen Partei der Arbeiterklasse, dem sozialistischen Recht und der sozialistischen Gesetzlichkeit richtig zu verstehen, muß davon ausgegangen werden, daß das sozialistische Recht und die sozialistische Gesetzlichkeit ihre objektive Grundlage in der historischen Notwendigkeit selbst haben, die von der Partei der Arbeiterklasse entsprechend den jeweiligen Entwicklungsbedingungen aufgedeckt und bewußtgemacht wird. Das sozialistische Recht und die sozialistische Gesetzlichkeit dienen einzig und allein der Verwirklichung der objektiven Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung. Davon ausgehend muß bewußtgemacht werden, daß die Parteilichkeit unseres sozialistischen Rechts in der exakten Verwirklichung dieser objektiven Gesetzmäßigkeiten besteht, daß es keine Parteilichkeit in der Anwendung des sozialistischen Rechts außerhalb dieser historischen Notwendigkeit gibt, daß Parteilichkeit und Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung im sozialistischen Recht eine untrennbare Einheit bilden, daß Verstöße gegen das sozialistische Recht und die sozialistische Gesetzlichkeit der sozialistischen Gesellschaft wesensfremd und mit der Entwicklung unvereinbar sind und daß, wie Lenin uns lehrt - die geringste Ungesetzlichkeit eine Lücke ist, die von den Feinden ausgenutzt wird.«
55 Diese Linie wird seitdem konsequent weiter verfolgt. Es wird deutlich gemacht, daß die sozialistische Gesetzlichkeit auch Bedeutung über die Justiz hinaus hat. Auf dem VIII. Parteitag der SED forderte deren Erster Sekretär Erich Honecker: »Die sozialistische Gesetzlichkeit zu festigen, ist aber nicht nur Sache der Justizorgane und der in der Rechtspflege unmittelbar tätigen Bürger. Es geht darum, daß überall im täglichen Leben unserer Gesellschaft die Einhaltung des sozialistischen Rechts und bewußte Disziplin zur festen Gewohnheit der Menschen werden« (Neues Deutschland vom 16.6.1971).
Das Parteiprogramm der SED von 1976 (S. 59) geht so weit, daß es ausdrücklich Sanktionen für die Verletzung des sozialistischen Rechts verlangt: »Die strikte Wahrung der sozialistischen Gesetzlichkeit erfordert, Verletzungen des Rechts in gebührender Weise zu ahnden.« Das Lehrbuch »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie« kehrt heraus (S. 394), daß die sozialistische Gesetzlichkeit sowohl für die Rechtsetzung als auch für die Rechtsanwendung gilt: »Die sozialistische Gesetzlichkeit erfordert, alle jene gesellschaftlichen Verhältnisse, die der rechtlichen Gestaltung und des rechtlichen Schutzes bedürfen, rechtlich zu regeln, sowie die strikte Einhaltung der rechtlichen Regelung von allen Bürgern, Staatsorganen, Kollektiven und Organisationen.« Neu ist die Forderung nach rechtlicher Regelung alles dessen, was rechtlicher Regelung bedarf.
Innerhalb der sozialistischen Gesetzlichkeit hat die Parteilichkeit ihre Bedeutung dann beibehalten, wenn es um Interpretation von Rechtsnormen geht. »Auslegung ermittelt den Inhalt des in der Rechtsnorm ausgedrückten Klassenwillens sowie ihr gesellschaftliches Ziel. Auslegung ist ein parteilicher Vorgang« (Lehrbuch »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie«, S. 478).
Nach Gotthold Bley/Frohmut Müller (Gesetzlichkeit und Leitungstätigkeit im Leninschen Sinne) gehört zu den Prinzipien der sozialistischen Gesetzlichkeit deren Einheit, die durch den demokratischen Zentralismus (s. Rz. 7-14 zu Art. 2) erreicht werden soll. (Weiteres zum Verhältnis zwischen sozialistischer Gesetzlichkeit und demokratischem Zentralismus s. Rz. 13 zu Art. 2).
56 b) In der Verfassung von 1968/1974. Wenn die Verfassung von 1968/1974 den Begriff der sozialistischen Gesetzlichkeit in der Überschrift zu Abschnitt IV verwendet, so ist damit die Bindung an das sozialistische Recht in seiner spezifischen Funktion gemeint, den Erfordernissen der objektiven Gesetze des Sozialismus, vor allem der planmäßigen Weiterentwicklung der sozialistischen Ordnung zu dienen. Da dem sozialistischen Recht die Parteilichkeit nach dieser Seite immanent ist, kann von einer dialektischen, das heißt widersprüchlichen Einheit von strikter Anwendung der Gesetze und der Parteilichkeit ihrer Anwendung nicht mehr gesprochen werden. Die Anwendung des sozialistischen Rechts ist nur strikt, wenn sie parteilich ist. Die Auslegung sozialistischer Rechtsnormen muß parteilich sein, weil diese selbst parteilich gestaltet sind und eine Auslegung im Sinne der Parteilichkeit verlangen.
Das technische Mittel zu einer derartigen Gestaltung sind Generalklauseln und die Verwendung ausfüllungsbedürftiger Begriffe. Von ihnen wird häufig Gebrauch gemacht. Jedoch steht ihrer schrankenlosen Verwendung das allgemeine Bedürfnis entgegen, mit den Rechtsnormen möglichst konkrete Verhaltensnormen zu geben. Das gilt insbesondere dann, wenn es um die Regelung von Detailfragen geht, aber durchaus nicht immer nur dann. Das Bedürfnis besteht auch, wenn es etwa gilt, Kompetenzen von Staatsorganen festzulegen. Es ist sogar eine Tendenz festzustellen, Rechtsnormen konkret und präzise zu gestalten. Deshalb kann es Vorkommen, daß derartige Rechtsnormen durch die Entwicklung als überholt erscheinen. In einem derartigen Falle hat nach dem jetzigen Stand der Rechtstheorie die Einhaltung der Rechtsnormen den Vorrang. Dem folgt auch die Praxis. Symptomatisch dafür ist das Urteil des OG vom 23.6.1967 (NJ 1967, S. 583), das also schon vor Erlaß der Verfassung erging. Darin führt das OG zur Erwägung, inwieweit die gesellschaftlichen Veränderungen bei der Anwendung des Rechts zu berücksichtigen seien, aus, es sei die Grenze zu beachten, die der Auslegung vom Inhalt der jeweils anzuwendenden Rechtsnorm selbst gezogen werde. Eine Auslegung, mit deren Hilfe ein Gesetz gegen seinen eindeutigen Inhalt angewendet werde, sei nicht nur widersinnig, sondern auch ungesetzlich.
57 c) Aufwertung des Rechts. Damit erfährt die Rolle des Rechts eine Aufwertung. Gegenüber den Auffassungen von Karl Polak liegt hier eine bemerkenswerte Veränderung vor.
Ursächlich dafür ist, daß die DDR sich in einer Phase der Konsolidierung befindet.
Das politische System der sozialistischen Gesellschaft kann nur funktionieren und funktionstüchtig bleiben, wenn seine Verhaltensregeln abstrakt, klar und unzweideutig sind (Uwe-Jens Heuer, Wissenschaftliche Wirtschaftsführung und Recht, S. 997; ders., Sozialistische Wirtschaftsführung und sozialistisches Recht, S. 28; Heinz Buch/Siegfried Petzold/Gerhard Schüßler, Leitungstätigkeit und sozialistisches Recht).
Im gesellschaftlichen System des Sozialismus spielt das Recht eine bedeutende Rolle. Ausdruck dessen ist das Parteiprogramm der SED von 1976. Darin heißt es (S. 58): »Das sozialistische Recht ist Ausdruck der Macht der Arbeiterklasse. Es dient der Verwirklichung der Interessen der Werktätigen, dem Schutz der sozialistischen Ordnung und der Freiheit und Menschenwürde der Bürger.« Trotzdem spielt der Begriff des »Rechtsstaates« nach Diskussionen in den Jahren 1945-1948 und 1961-1968 (Klaus Sieveking, Die Entwicklung des sozialistischen Rechtsstaatsbegriffs in der DDR) keine Rolle, auch nicht mit dem Epitheton »sozialistisch«.
58 d) Ausbau des sozialistischen Rechtssystems. Ermöglicht wird die neue Einstellung durch den Ausbau des sozialistischen Rechtssystems. Dieses ist das Ergebnis eines längeren Prozesses mit verschiedenen Entwicklungsphasen. Solange und soweit noch nicht sozialistische Rechtsnormen gesetzt waren, mußte sich das revolutionäre Regime mit den vorhandenen Rechtsnormen aus der vorrevolutionären Zeit begnügen. Sie wurden auch noch weiter als in Geltung befindlich angesehen, aber sie wurden im neuen Geiste ausgelegt. Obwohl die vorrevolutionären Rechtsnormen nach der marxistisch-leninistischen Rechtstheorie so gestaltet waren, daß sie dem vorrevolutionären Regime dienen sollten, wurden sie nunmehr nach dem Prinzip der sozialistischen Gesetzlichkeit interpretiert und angewendet. Es erhellt, daß sich hier ein Widerspruch zwischen Inhalt und Anwendung ergeben konnte, ja zwangsläufig ergeben mußte. Hinsichtlich der vorrevolutionären Rechtsnonnen, die als weiterhin in Geltung befindlich angesehen wurden - »tradierte« Rechtsnormen genannt stellte sich das Problem der Bindung anders als hinsichtlich der sozialistischen Rechtsnormen. Hier hatte die Parteilichkeit der Anwendung den unbedingten Vorzug vor der strikten Einhaltung, die auf eine Anwendung im vorrevolutionären Geiste hinausliefe. Auf dem Hintergrund der Geltung noch zahlreicher Rechtsnormen aus der Zeit vor 1945 ist die Definition von Hilde Benjamin von 1958 zu sehen. Hier hatte das Postulat der Parteilichkeit der Anwendung im Sinne dessen, was der Marxismus-Leninismus als Fortschritt ansieht, ein ganz anderes Gewicht als bei der Anwendung sozialistischer Rechtsnormen, denen diese Parteilichkeit bereits immanent ist.
59 Im Gebiet der heutigen DDR wurden zwar bereits vor ihrer Entstehung von der sowjetischen Besatzungsmacht, den Organen der Länder und der Deutschen Wirtschaftskommission Rechtsnormen gesetzt, die der neuen Entwicklung dienen sollten. Aber in diesem Stadium verlief der Prozeß der Umwandlung der Rechtsordnung noch zögernd und partiell. Auch mit der Gründung der DDR trat noch keine grundlegende Änderung ein. Man befand sich damals noch in der Ubergangsphase der antifaschistisch-demokratischen Ordnung. In ihr wurde zwar schon »fortschrittliches«, aber noch kein sozialistisches Recht gesetzt. Nachdem auf dem V. Parteitag der SED im Juli 1958 der Eintritt in die »Periode des vollentfalteten Aufbaus des Sozialismus« verkündet worden war, wurde mit dem im Oktober 1958 vom Justizministerium entworfenen Sieben jahrplan eine totale Umwandlung der Rechtsordnung ins Auge gefaßt (Albrecht Zorn, Der Siebenjahresplan der Sowjetzone zur Umwandlung des Rechts). Von allen damals ins Auge gefaßten Projekten wurden jedoch nur zwei Gesetze termingerecht oder nahezu termingerecht erlassen: das Gesetz über die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften v. 3.6.1959 (GBl. DDR Ⅰ 1959, S. 577) und das Gesetz über die Wahl der Richter der Kreis- und Bezirksgerichte durch die örtlichen Volksvertretungen v. 1.10.1959 (GBl. DDR Ⅰ 1959, S. 751), verbunden mit einer Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes [Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gerichtsverfassungsgesetzes v. 1.10.1959 (GBl. DDR Ⅰ 1959, S. 753)]. Die Arbeiten für ein neues Strafgesetzbuch, ein Zivilgesetzbuch und eine neue Zivilprozeßordnung blieben stecken. Außerhalb des Planes wurde jedoch das Gesetzbuch der Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik vom 12.4.1961 [Gesetzbuch der Arbeit (GBA) der Deutschen Demokratischen Republik v. 12.4.1961 (GBl. DDR Ⅰ 1961, S. 27) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Gesetzbuches der Arbeit v. 17.4.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 63) und des Zweiten Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Gesetzbuches der Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik v. 23.11.1966 (GBl. DDR Ⅰ 1966, S. 111), des Gesetzes zur Änderung gesetzlicher Bestimmungen v. 26.5.1967 (GBl. DDR Ⅰ 1967, S. 89), des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch und zur Strafprozeßordnung der Deutschen Demokratischen Republik v. 12.1.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 97), des Gesetzes über die gesellschaftlichen Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik - GGG - v. 11. 6.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 229) und des Gesetzes über die Teilnahme der Jugend an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und über ihre allseitige Förderung in der Deutschen Demokratischen Republik - Jugendgesetz der DDR - v. 28.1.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1974, S. 45)] erlassen. Mit dem VI. Parteitag der SED im Januar 1963 wurde ein neuer Anlauf genommen. In dem auf diesem Parteitag angenommenen Parteiprogramm heißt es, die SED stelle die Aufgabe, die sozialistischen Rechtsnormen zu vervollkommnen, die das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen regeln und die die wirtschaftlich-organisatorische und kulturell-erzieherische Tätigkeit der Staats- und Wirtschaftsorgane, die Beziehungen zwischen ihnen regeln und zur freien Entfaltung der Kräfte, Talente und Fähigkeiten der Menschen beitragen. »Es sind neue Gesetzbücher des Zivil-, Straf- und Familienrechts auszuarbeiten.« Es ergingen in der folgenden Zeit neue Kodifikationen, angefangen mit dem [Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die grundsätzlichen Aufgaben und die Arbeitsweise der Organe der Rechtspflege v. 4.4.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 21), der Militärgerichtsordnung vom 4.4.1963 [Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Stellung und die Aufgaben der Gerichte für Militärstrafsachen (Militärgerichtsordnung) v. 4.4.1962 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 71)], dem Gesetz über die Verfassung der Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik (Gerichtsverfassungsgesetz) v. 17.4.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 45) und dem Gesetz über die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen Republik v. 17.4.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 57) über das Gesetz über die Teilnahme der Jugend der Deutschen Demokratischen Republik am Kampf um den umfassenden Aufbau des Sozialismus und die allseitige Förderung ihrer Initiative bei der Leitung der Volkswirtschaft und des Staates, in Beruf und Schule, bei Kultur und Sport - Jugendgesetz der DDR - v. 4.5.1964 (GBl. DDR Ⅰ 1964, S. 75), das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem v. 25.2.1965 (GBl. DDR Ⅰ 1965, S. 83), das Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik v. 20.12.1965 (GBl. DDR Ⅰ 1966, S. 1), das Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik (Staatsbürgerschaftsgesetz) v. 20.2.1967 (GBl. DDR Ⅰ 1967, S. 3), das Strafgesetzbuch vom 12.1.1968 [Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik - STGB - v. 12.1.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 1) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches v. 19.12.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1975, S. 14), des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung straf- und strafverfahrensrechtlicher Bestimmungen (2. Strafrechtsänderungsgesetz) v. 7.4.1977 (GBl. DDR Ⅰ 1977, S. 100) und des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung straf- und strafverfahrensrechtlicher Bestimmungen (3. Strafrechtsänderungsgesetz) v. 28.6.1979 (GBl. DDR Ⅰ 1979, S. 139)], die Strafprozeßordnung vom 12.1.1968 [Strafprozeßordnung der Deutschen Demokratischen Republik - StPO - v. 12.1.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 49) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung der Strafprozeßordnung der Deutschen Demokratischen Republik - StPO - v. 19.12.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1975, S. 62), des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung straf- und strafverfahrensrechtlicher Bestimmungen (2. Strafrechtsänderungsgesetz) v. 7.4.1977 (GBl. DDR Ⅰ 1977, S. 100)], das Ordnungswidrigkeitengesetz vom 12.1.1968 [Gesetz zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - v. 12.1.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 101) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten v. 19.12.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1974, S. 591) und des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten v. 28.6.1979 (GBl. DDR Ⅰ 1979, S. 139)] und das Gesetz über den Vollzug von Strafen mit Freiheitsentzug und über die Wiedereingliederung Strafentlassener in das gesellschaftliche Leben (Strafvollzugs- und Wiedereingliederungsgesetz) - SVWG - v. 12.1.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 109). Als Höhepunkt der Entwicklung wird der Erlaß der Verfassung von 1968 bezeichnet (Reiner Arlt, Zu einigen Grundfragen der marxistisch-leninistischen Rechtstheorie in der DDR, S. 1423).
60 Aus der Zeit danach sind zu nennen: das Gesetz über die gesellschaftlichen Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik - GGG - v. 11. 6.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 229) und das Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Deutschen Volkspolizei v. 11.6.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 232), das
Berggesetz der Deutschen Demokratischen Republik v. 12.5.1969 (GBl. DDR Ⅰ 1969, S. 29) und das Gesetz zur Regelung der Staatshaftung in der Deutschen Demokratischen Republik - Staatshaftungsgesetz - v. 12.5.1969 (GBl. DDR Ⅰ 1969, S. 34), das Gesetz über die Zivilverteidigung in der Deutschen Demokratischen Republik - Zivilverteidigungsgesetz - v. 16.9.1970 (GBl. DDR Ⅰ 1970, S. 289), das für die Erhöhung der Rechtsstabilität bedeutsame Gesetz über die Neufassung von Regelungen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen staatlicher Organe v. 24.6.1971 (GBl. DDR Ⅰ 1971, S. 49) und die entsprechende Verordnung vom gleichen Tage [Verordnung über die Neufassung von Regelungen über Rechtsmittel gegen Entscheidungen staatlicher Organe v. 24.6.1971 (GBl. DDR ⅠⅠ 1971, S. 465)] sowie das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft v. 9.3.1972 (GBl. DDR Ⅰ 1972, S. 89). Mit einem neuen
Gesetz über den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik (MinRG) v. 16.10.1972 (GBl. DDR Ⅰ 1972, S. 253) wurden rechtliche Konsequenzen aus der Entmachtung des Staatsrates seit dem Beginn der Honeckerära (s. Erl. zu Art. 66 und Art. 76) gezogen. Zu nennen ist weiterhin das Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsbürgerschaft v. 16.10.1972 (GBl. DDR Ⅰ 1972, S. 265), durch das eine schwere Belastung des innerdeutschen Verhältnisses beseitigt wurde, indem es die völkerrechtswidrige Inanspruchnahme von DDR-Flüchtlingen als Staatsbürger der DDR beendete (s. Rz. 81 zu Art. 19). Es folgte eine Reihe von Gesetzen, die als Ausdruck der neuen Entwicklung insofern betrachtet werden können, als sie klarer, verständlicher sowie präziser abgefaßt sind, als es frühere Gesetzgebungswerke in der DDR waren. Dabei wurden auch Materien neu geregelt, die bereits in früheren Etappen der Entwicklung Gegenstand der DDR-Gesetzgebung gewesen waren. Dazu gehören das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe in der Deutschen Demokratischen Republik (GöV) v. 12.7.1973 (GBl. DDR Ⅰ 1973, S. 313), das Gesetz über den Verkehr mit Suchtmitteln - Suchtmittelgesetz - v. 19.12.1973 (GBl. DDR Ⅰ 1973, S. 572), das Devisengesetz v. 19.12.1973 (GBl. DDR Ⅰ 1973, S. 574), ein neues Jugendgesetz vom 28.1.1974 [Gesetz über die Teilnahme der Jugend an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und über ihre allseitige Förderung in der Deutschen Demokratischen Republik - Jugendgesetz der DDR - v. 28.1.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1974, S. 45)] und ein neues Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.9.1974 [Gesetz über die Verfassung der Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik - Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) - v. 27.9.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1974, S. 457)]. Einen Höhepunkt bildete die Verfassungsnovelle vom 7.10.1974 [Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik v. 7.10.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1974, S. 425)].
61 Es folgten das Gesetz über die Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik v. 19.12.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1974, S. 580), das langerwartete
Zivilgesetzbuch (ZGB) der Deutschen Demokratischen Republik v. 19.6.1975 (GBl. DDR Ⅰ 1975, S. 465), das Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtsachen - Zivilprozeßordnung - v. 11.7.1975 (GBl. DDR Ⅰ 1975, S. 533), das Rechtsanwendungsgesetz vom 5.12.1975 [Gesetz über die Anwendung des Rechts auf internationale zivil-, familien- und arbeitsrechtliche Beziehungen sowie auf internationale Wirtschaftsverträge - Rechtsanwendungsgesetz - v. 5.12.1975 (GBl. DDR Ⅰ 1975, S. 748)], das die Normen des Internationalen Privatrechts (IPR) der DDR enthält, das Gesetz über internationale Wirtschaftsverträge - GIW - v. 5.2.1976 (GBl. DDR Ⅰ 1976, S. 61), das anzuwenden ist, wenn in internationalen Wirtschaftsbeziehungen DDR-Recht gelten soll, das Seehandelsschiffahrtsgesetz der Deutschen Demokratischen Republik - SHSG - v. 5.2.1976 (GBl. DDR Ⅰ 1976, S. 109), das Gesetz über das Staatliche Notariat - Notariatsgesetz - v. 5.2.1976 (GBl. DDR Ⅰ 1976, S. 93) und das Gesetz über die Wahlen zu den Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik - Wahlgesetz - v. 24.6.1976 (GBl. DDR Ⅰ 1976, S. 301). Im Jahre 1977 erging eine Reihe von neuen Justizgesetzen, die solche aus früheren Etappen der DDR-Entwicklung ersetzten: das Gesetz über die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen Republik v. 7.4.1977 (GBl. DDR Ⅰ 1977, S. 93), das Gesetz über die Wiedereingliederung der aus dem Strafvollzug entlassenen Bürger in das gesellschaftliche Leben (Wiedereingliederungsgesetz) v. 7.4.1977 (GBl. DDR Ⅰ, S. 98), das Gesetz über den Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug (Strafvollzugsgesetz) - StVG - v. 7.4.1977 (GBl. DDR Ⅰ 1977, S. 109) sowie ein neues Arbeitsgesetzbuch der DDR vom 16.6.1977 [Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik (AGB) v. 16.6.1977 (GBl. DDR Ⅰ 1977, S. 185)], das das Gesetzbuch der Arbeit (GBA) der Deutschen Demokratischen Republik v. 12.4.1961 (GBl. DDR Ⅰ 1961, S. 27) ablöste. Das Jahr 1978 brachte ein neues Verteidigungsgesetz vom 13.10.1978 [Gesetz über die Landesverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik (Landesverteidigungsgesetz) v. 13.10.1978 (GBl. DDR Ⅰ 1978, S. 377)], durch das auch das Gesetz über die Zivilverteidigung in der Deutschen Demokratischen Republik - Zivilverteidigungsgesetz - v. 16.9.1970 (GBl. DDR Ⅰ 1970, S. 289) aufgehoben wurde.
62 Eine Gesamtkodifikation des Wirtschaftsrechts steht immer noch aus. Eine solche ist wohl auch für absehbare Zeit nicht mehr beabsichtigt (Siegfried Mampel, Zum gegenwärtigen Stand des Wirtschaftsrechts in der DDR). Indessen ist das Wirtschaftsrecht partiell weiterentwickelt worden. Auf dem Gebiet des Organisationsrechts ist zu nennen die Verordnung über die Aufgaben, Rechte und Pflichten der volkseigenen Betriebe, Kombinate und VVB v. 28.3.1973 (GBl. DDR Ⅰ 1973, S. 129) in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufgaben, Rechte und Pflichten der volkseigenen Betriebe, Kombinate und VVB v. 27.8.1973 (GBl. DDR I 1973, S. 405), die durch die Verordnung über die Kombinate, Kombinatsbetriebe und volkseigenen Betriebe v. 8.11.1979 (GBl. DDR Ⅰ 1979, S. 355) abgelöst wurde. Auf dem Gebiet des Planungsrechts ergingen die Planungsordnungen vom 20.11.1974 (GBl. DDR 1974, Sdr. Nr. 775 a-c) und die Rahmenrichtlinie für die Jahresplanung der Betriebe und Kombinate der Industrie und des Bauwesens vom 28.11.1964 (GBl. DDR 1964, Sdr. Nr. 780), denen die Grundsätze der Ordnung der Planung der Volkswirtschaft 1981-1985 und die daraus abgeleitete Planungsordnung 1981-1985 vom 28.11.1979 (GBl. DDR 1979, Sdr. Nr. 1020) sowie die Rahmenrichtlinie für die Planung in den Kombinaten und den Betrieben der Industrie und des Bauwesens vom 30.11.1979 (GBl. DDR 1979, Sdr. Nr. 1021) folgten. Auf dem Gebiet des Vertragsrechts steht ein »Kooperationsgesetz« in Aussicht. Bei der weiteren Planung der Rechtsetzung soll vor allem die Qualität der Rechtsnormen verbessert werden (Karl Becher, Zur Planung der Rechtsetzung aus rechtsvergleichender Sicht, S. 348).
5. Das Verständnis der Rechtssicherheit
63 a) Die Rechtssicherheit, die von der DDR gewährleistet werden soll, kann nur die Sicherheit sein, die das sozialistische Recht und die sozialistische Gesetzlichkeit geben können. Dabei ist die sozialistische Gesetzlichkeit das Mittel, mit dessen Hilfe dem sozialistischen Recht Sicherheit gegeben werden soll. So verstanden, müßte Art. 19 Abs. 1 Satz 2 eigentlich lauten: »Sie (d. h. die DDR) gewährleistet die sozialistische Gesetzlichkeit und damit Rechtssicherheit.« Sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtssicherheit sind nicht identisch. Die eine ist die Folge der anderen.
Rechtssicherheit in diesem Verständnis ist also nicht die Erfüllung einer notwendigen Funktion in der Erfassung und Verwirklichung der Rechtsidee. Sie wird in der DDR vielmehr nur gewährt entsprechend den Erfordernissen der gesellschaftlichen Entwicklung. Klar und eindeutig ist das sozialistische Recht in seinem Telos. Was dieses aber in einer bestimmten Entwicklungsphase verlangt, ist in der Regel in den Präambeln der Gesetze -so auch in der Präambel der Verfassung - angegeben. Was die Entwicklung konkret in einem bestimmten Moment fordert, wird jeweils offengelassen und richtet sich nach den Beschlüssen der Parteiführung, die Richtschnur für die Interpretation sind. Einigermaßen zweifelsfrei ist der Inhalt des Rechts nur, solange die Parteibeschlüsse gelten. Weil diese jederzeit geändert werden können, ist der Inhalt des Rechts wandelbar. Es fehlt ihm weitgehend Bestimmtheit und Berechenbarkeit. Die Organisation der Gerichtsbarkeit nach dem Grundsatz der Gewalteneinheit garantiert die Durchsetzung und einheitliche Anwendung des Rechts, aber auch die Anpassung an neue Interpretationen. Verläßlichkeit im Ablauf der Zeit ist also nicht gegeben.
Die in der Phase der Konsolidierung der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung mit dem Ausbau des sozialistischen Rechtssystems geforderte Bindung an die Rechtsnormen setzt zwar der Interpretation nunmehr gewisse Schranken, vor allem dort, wo der Wortlaut einer Norm eindeutig ist, und verweist Anpassungen auf den Weg der Gesetzgebung. Damit ist in einem gewissen Grad das erreicht, was mit Stabilität des Rechts zu bezeichnen ist. Diese Stabilität ist aber nur relativ, weil wegen der jederzeit gegebenen Möglichkeit einer Neuinterpretation dem Recht die Dynamik erhalten bleibt.
So wird die Rechtssicherheit im Verständnis der Verfassung gewährt durch die einheitliche Anwendung des Rechts, seine Durchsetzbarkeit und durch eine gewisse Stabilität. Da dem Recht aber die Verläßlichkeit im Ablauf der Zeit, also die Berechenbarkeit fehlt, ist Rechtssicherheit im Verständnis der Verfassung nicht mit dem Begriff der Rechtssicherheit gleichzusetzen, wie er von der herkömmlichen Rechtslehre verwendet wird. Ernst-Wolfgang Böckenförde (Die Rechtsauffassung im kommunistischen Staat, S. 42) weist zutreffend darauf hin, daß die Bedeutung, die gesetzlichen Fixierungen zur Zeit zuteil wird, nicht auf einer Beständigkeit des Rechts beruht, sondern ebenfalls Ausdruck seiner politischen Funktion ist.
Trotzdem bedeutet die Gewährung der Rechtssicherheit in dem Verständnis der Verfassung für die Rechtsunterworfenen einen höheren Grad an Sicherheit, als er in der Zeit gegeben war, in der die Forderung nach Rechtssicherheit als Ausdruck eines rückschrittlichbürgerlichen Rechtsdenkens ausgegeben wurde, damit der Entwicklung nach den Erkenntnissen der marxistisch-leninistischen Partei keine Hindernisse in den Weg gelegt werden konnten.
64 b) Ein Zeichen der erhöhten Stabilität des Rechts ist Art. 106, wonach die Verfassung nur durch die Volkskammer durch Gesetz geändert werden kann, das ihren Wortlaut ausdrücklich ändert oder ergänzt. Die Weiterentwicklung der Verfassung außerhalb der Verfassungsurkunde, wie sie unter der Geltung der Verfassung von 1949 üblich war, ist damit untersagt. Da aber Art. 71 Neuinterpretationen durch Staatsrat und Volkskammer ermöglicht, ist auch die Stabilität der Verfassung nur relativ (s. Erl. zu Art. 106).
6. Rechtserziehung, Rechtsarbeit, Rechtsbewußtsein
65 Die erhöhte Rolle des Rechts drückt sich darin aus, daß Anstrengungen unternommen werden, auf der einen Seite die Menschen an der Basis, vor allem die Werktätigen in den Betrieben und die Jugend, zu einer höheren Achtung vor dem Recht zu erziehen, auf der anderen Seite die Staats- und Wirtschaftsorgane dazu zu bringen, mit den Rechtsnormen, das heißt vor allem bewußt auf der Grundlage der Rechtsnormen, zu »arbeiten«. Das Signal dafür setzte das Politbüro des ZK der SED. Durch dessen Bericht an die 12. Tagung des ZK der SED (Neues Deutschland vom 5.7.1974) wurde ein offenbar schon viel früher gefaßter Beschluß dieses Organs »Die nächsten Aufgaben zur Erläuterung des sozialistischen Rechts sowie zur weiteren Festigung des Rechtsbewußtseins der Werktätigen« bekannt. Das Recht soll danach obligatorischer Bestandteil der Aus- und Weiterbildung der Staats- und Wirtschaftsfunktionäre werden. An den allgemeinbildenden Schulen sowie den Fach- und Hochschulen soll planmäßig Rechtserziehung betrieben werden. Die kulturellen Institutionen sollen mit den Mitteln der Literatur und Kunst zur Festigung des sozialistischen Rechtsbewußtseins beitragen. An die Massenmedien werden entsprechende Anforderungen gestellt.
Es geht dabei sowohl um die Vermittlung von Rechtskenntnissen als auch um die Schaffung eines Rechtsbewußtseins.
66 Auf derselben Linie liegen der Beschluß des Sekretariats des Zentralrates der FDJ vom 25.4.1974 »Maßnahmen der FDJ zur Erhöhung des Rechtsbewußtseins der Jugendlichen und zur politischen Arbeit mit den Jugendlichen, die in ihrer sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung Zurückbleiben« (Christian Wehner, Aufgaben der FDJ zur Erhöhung des Rechtsbewußtseins der Jugendlichen) und der Beschluß des Präsidiums des Bundesvorstandes des FDGB vom 2.8.1974 »Aufgaben der Gewerkschaften zur Erläuterung des sozialistischen Rechts sowie der Weiterentwicklung des Rechtsbewußtseins der Werktätigen« (Rudi Kranke, Nutzen wir noch besser unser sozialistisches Recht!). Schon vorher war von der SED in den Betrieben eine »Masseninitiative« als Bestandteil des Wettbewerbs in Gang gesetzt worden, die unter dem Motto »Gewährleistung einer mustergültigen Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit« läuft. Dabei ging es vor allem um die Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit. Rechtsfragen sollten nicht mehr als Ressortangelegenheit der Leitung behandelt werden (Gustav Jahn/Siegfried Winkler, Weitere Entfaltung der Masseninitiative im Kampf um Bereiche der vorbildlichen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Betrieb). Die Initiative wurde später auch auf die Wohnbezirke ausgedehnt (Klaus Sorgenicht, Die Erhöhung der Wirksamkeit der staatlichen Leitung - eine Schlüsselfrage der Wirksamkeit der staatlichen Gesellschaft, S. 1779). Es wurde ein eigener Ehrentitel: »Bereich (Betrieb) der vorbildlichen Ordnung und Sicherheit« geschaffen.
An die Staatsorgane wandte sich der »Beschluß über die Verbesserung der Rechtsarbeit in der Volkswirtschaft« vom 13.6.1974 (GBl. DDR I 1974, S. 513). Darin wurde den Ministern, den Leitern der anderen zentralen Staatsorgane, den Vorsitzenden der örtlichen Räte, den Leitern der wirtschaftsleitenden Organe, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen zur besonderen Pflicht gemacht, »die Durchsetzung des sozialistischen Rechts als Instrument zur Organisation des bewußten, planmäßigen, gemeinschaftlichen Handelns der Werktätigen mit hoher Wirksamkeit zu sichern«.
67 Es handelt sich hier zweifellos nicht um ein Propagandamanöver von relativ kurzer Dauer. Der Wert des sozialistischen Rechts als Instrument der Partei- und Staatsführung ist erkannt. Deshalb muß bei den Menschen in den Betrieben und bei der Jugend die zweifellos bei den Älteren aus traditionellen Gründen, bei den Jüngeren als allseits zu beachtende Erscheinung vorhandene Rechtsfeindschaft abgebaut (Siegfried Mampel, Die Rolle des Rechts in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft der DDR, S. 724/725) und durch eine gesetzestreue Haltung ersetzt werden.
Diese Haltung soll nicht durch Zwang erzeugt werden. Vielmehr ist der Sinn, durch Rechtserziehung Rechtsbewußtsein zu schaffen und zu schärfen. Es geht dabei nicht um das Recht als Selbstwert. Einen solchen erkennt die marxistisch-leninistische Rechtslehre nicht an. »Das sozialistische Rechtsbewußtsein ist von der staatlichen Machtausübung der Arbeiterklasse und ihrer Bündnispartner nicht zu trennen.« So heißt es im Lehrbuch »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie« (S. 380).
Zweifellos wird durch diese Anstrengungen auch die Stabilität des Rechts gefördert, was im Interesse auch des einzelnen liegt. Der instrumentale Charakter des sozialistischen Rechts sorgt freilich dafür, daß diese Stabilität stets eine relative bleibt.

V. Die Grundsätze der sozialistischen Moral
1. Wesen und Inhalt der sozialistischen Moral
68 Art. 19 Abs. 3 Satz 3 verpflichtet die Bürger, ihre Beziehungen durch gegenseitige Achtung und Hilfe, durch die Grundsätze sozialistischer Moral zu prägen.
69 a) Die marxistisch-leninistische Lehre geht davon aus, daß es außer den Rechtsnormen auch andere Verhaltensregeln gibt: soziale Normen, vor allem die Normen der Moral. Sie meint, daß auch diese Klassencharakter haben (Lehrbuch »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie«, S. 446). Ebensowenig wie ein ewiges Recht gibt es nach ihr keine absolute, ewige Moral, sondern verschiedene Moralsysteme. Die Moral sei eine Form des gesellschaftlichen Bewußtseins und ergebe sich aus den Interessen und Aufgaben, aus der ökonomischen Lage der verschiedenen Klassen. So existiere ein Moralsystem der bürgerlich-kapitalistischen Ausbeuter und ein anderes der Arbeiterklasse (Hermann Klenner, Der Marxismus-Leninismus über das Wesen des Rechts, S. 90). In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung beständen daher mehrere Moralsysteme nebeneinander, vor allem das der Bourgeoisie und das des Proletariats. In der sozialistischen Gesellschaftsordnung setze sich immer mehr ein einheitliches Moralsystem durch, das den Interessen der Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten Klassen und Schichten entspreche. Es wird mit »sozialistischer Moral« bezeichnet.
70 b) Walter Ulbricht (Über die Dialektik unseres sozialistischen Aufbaus, S. 185) hatte die Grundsätze sozialistischer Moral, offenbar in bewußter Anlehnung an den jüdisch-christlichen Dekalog, in zehn Geboten der sozialistischen Moral zusammengefaßt. Sie sind inzwischen außer Kurs geraten.
71 c) Das Gebot der gegenseitigen Achtung und Hilfe, in Art. 19 Abs. 3 Satz 3 als besondere Maxime gesondert von den Grundsätzen sozialistischer Moral aufgeführt, soll offenbar seine Bedeutung hervorheben.
2. Verhältnis der Moralnormen zu den Rechtsnormen
72 Über den Unterschied zwischen den Rechtsnormen und den Geboten der Moral und über ihr Verhältnis zueinander haben sich die Ansichten gewandelt. Ursprünglich (z. B. von Hermann Klenner) wurde angenommen, daß sich die Rechtsnormen von den Moralnormen dadurch unterscheiden, daß die einen durch den Staat gesetzt werden und die anderen ihren Ursprung allein in der Gesellschaft haben. Die Durchsetzung der Rechtsnormen werde vom Staat erzwungen, die der Moralnormen beruhe auf dem sittlichen Bewußtsein der Menschen, das zu schaffen Aufgabe der gesellschaftlichen Kräfte sei. Trotzdem wurde schon damals angenommen, daß die Einhaltung der Moralnormen nicht in das Belieben des einzelnen gestellt sei. Die gesellschaftlichen Kräfte hätten durch Ausübung von sozialem Druck für ihre Einhaltung zu sorgen.
Wurden damals Rechtsnormen und Moralnormen noch scharf getrennt, so wies 1961 Rudolf Schneider (Der Entwurf des neuen sozialistischen Arbeitsgesetzbuches der Deutschen Demokratischen Republik - ein Lehrbuch der deutschen Arbeiterklasse, S. 13) darauf hin, daß in der DDR die rechtlichen Normen in zunehmendem Maße durch die Gesellschaft, durch die politisch-moralische Autorität der Kollektive gesichert würden. Andererseits sei die gesamte Tätigkeit des Staates immer mehr auf die Erziehung zur bewußten Einhaltung der sozialistischen Moralforderungen gerichtet. Das zu übersehen hieße, den sozialistischen Staat und sein Recht von der sozialistischen Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu trennen. Dem Wesen nach sei das »Ineinanderwachsen« von Moral und Recht im Sozialismus eine Form, in der sich Staat und Gesellschaft, Staat und Volksmassen immer mehr verbänden.
Damit war die Unterscheidung nach dem Kriterium der Herkunft der Zwangsgewalt zur Durchsetzung weitgehend hinfällig geworden. Auf jeden Fall war der Unterschied nun nicht mehr prinzipiell. Berücksichtigt man die spezifische Integration von Staat und Gesellschaft im politischen System der sozialistischen Gesellschaft (s. Rz. 14-21 zu Art. 1), so können sich tatsächlich allenfalls Unterschiede in der Methode der Durchsetzung und bei der Zuständigkeit der dabei tätigen Organe ergeben.
73 Indessen zeigte sich eine weitere Entwicklung, die die Unterscheidung nach den bislang angenommenen Kriterien vollends fragwürdig macht. In § 2 Abs. 2 Gesetzbuch der Arbeit (GBA) der Deutschen Demokratischen Republik v. 12.4.1961 (GBl. DDR Ⅰ 1961, S. 27) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Gesetzbuches der Arbeit v. 17.4.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 63) waren die Arbeit und die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten zur moralischen Pflicht eines jeden arbeitsfähigen Bürgers erklärt worden. Damit war erstmals eine moralische Pflicht durch eine Rechtsnorm begründet worden. Selbst wenn man die Ansicht verträte, daß durch die Rechtsnorm lediglich ein Moralgebot bestätigt worden wäre, bedeutete dieser Vorgang nichts anderes als die Transformation einer gesellschaftlichen Verhaltensregel in eine, die vom Staat gesetzt wurde. Die »moralische« Pflicht zur Arbeit wird auch folgerichtig durch die Zwangsgewalt des Staates gesichert. Nach § 248 StGB kann u. a., wer sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden.
74 Wenn Art. 19 Abs. 3 Satz 3 die Anwendung der Grundsätze der sozialistischen Moral für die Beziehungen der Bürger anordnet, wird noch ein Schritt weitergegangen. Durch die Verfassung, also durch einen qualifizierten Akt des Staates, wird das gesamte sozialistische Moralsystem für rechtsverbindlich erklärt. Damit werden die Moralnormen jedoch noch nicht zu Rechtsnormen. Es gibt Moralnormen - wie etwa die Pflicht zur Arbeit, die nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 mit dem Recht auf Arbeit eine Einheit bildet -, welche gleichzeitig Rechtsnormen sind. In der Regel sind sie es jedoch nicht. Aufs ganze gesehen, bilden sie ein Kompendium von Regeln für ein Verhalten, das von der Masse der Bevölkerung noch nicht erwartet wird, zu dem sie erst gebracht werden soll. Die Grundsätze sozialistischer Moral sind als rechtsverbindliche Prinzipien zu verstehen, zu deren Einhaltung die Menschen erst gelenkt werden sollen. Dabei spielt die Bewußtseinsbildung, die Erziehung zum sozialistischen Menschen, in kritischer Sicht also die ideologische Indoktrination, die entscheidende Rolle. Das Verhältnis zwischen Recht und Moral wird in der jetzigen Version so gesehen, daß das Recht, also die staatlich gesetzten Verhaltensregeln, Einfluß auf die gesellschaftlichen Verhaltensregeln hat. Nach Walter Ulbricht (Die Rolle des sozialistischen Staates ..., S. 1755) besteht die prinzipielle Bedeutung der Gestaltung des Verhältnisses von sozialistischem Recht und sozialistischer Moral darin, die erzieherische Einflußnahme des Rechts auf die Herausbildung und allgemeine Durchsetzung sozialistischer Moralauffassungen, die mehr und mehr das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen bestimmten, zu verwirklichen. So konnte Reiner Arlt (Zu einigen Grundfragen der marxistisch-leninistischen Rechtstheorie in der DDR, S. 1429) schreiben, das Kriterium für das Verhältnis von Recht und Moral sei nicht die Erzwingbarkeit der Normen oder ihre freiwillige Einhaltung oder gar die Fragestellung des ethischen Minimums, sondern vielmehr das Verhältnis ihres Zusammenwirkens. Das Recht müsse durch seine konkrete Ausgestaltung und Überzeugungskraft wirksam dazu beitragen, sozialistische Moralauffassungen bei allen Werktätigen zu entwickeln, die mehr und mehr ihr Denken, Fühlen und Handeln bestimmten.
Folgerichtig heißt es im Lehrbuch »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie« (S. 446): »Ein Spezifikum der Moralnormen im Verhältnis zu allen anderen Sozialnormen besteht darin, daß sie keiner besonderen Institution bedürfen, die die Einhaltung der Moralnormen erzwingen. Die Kraft der Moralnormen beruht auf der Überzeugung, wie sie vom Wirken der Partei der Arbeiterklasse ausgeht, der öffentlichen Meinung, dem Beispiel oder anderen gesellschaftlichen Erscheinungen, denen eine moralische Autorität zukommt.« Stellt man das Wirken der SED in Rechnung, so kann kein Zweifel darüber auf-kommen, daß die Normen der sozialistischen Moral die gleiche zwingende Kraft haben wie Rechtsnormen.
75 Das Verhältnis der Moralnormen zu den Rechtsnormen charakterisiert das genannte Lehrbuch (a.a.O.) wie folgt: »Die sozialistische Moral ist eine ideelle Grundlage für das sozialistische Recht. Sozialistische Rechtsnormen unterliegen der moralischen Bewertung. Manche sozialistischen Rechtsnormen sind aus Moralnormen hervorgegangen. Daraus erklärt sich die Tatsache, daß es Normen gibt, die sowohl dem Recht wie der Moral angehören. Andere Rechtsnormen haben eine mittelbare moralische Beziehung; das trifft besonders auf bestimmte Normen des Prozeßrechts oder auf solche Normen zu, die organisatorische Festlegungen, Fristen usw. enthalten.«
Auf ideologischem Gebiet sollen die Wechselwirkungen zwischen Rechts- und Moralnormen eine große Rolle spielen. »Die sozialistische Moral hilft mit, die ideologischen Potenzen des sozialistischen Rechts zu entfalten; umgekehrt wird mit Hilfe des sozialistischen Rechts auch die sozialistische Moral weiter durchgesetzt.«
Diese ideologische Kraft der Wechselwirkung erfordert nach dem Lehrbuch (S. 447), daß keine Gegensätze zwischen einzelnen geltenden Rechtsnormen und der Moral auftre-ten. »Sie können entstehen, wenn die Gesetzgebung in einzelnen Bereichen hinter der sozialistischen Moralentwicklung zurückbleibt oder wenn veraltete Rechtsnormen nicht rechtzeitig außer Kraft gesetzt werden.« Abhilfe darf aber im Sinne der erhöhten Stabilität des Rechts nicht dadurch geschaffen werden, daß untergeordnete Staatsorgane und die Gerichte von sich aus Rechtsnormen für anwendbar erklären. Vielmehr gilt: »Solchen Widersprüchen muß vorgebeugt werden.« Dagegen sollen Widersprüche zwischen sozialistischem Recht und zurückgebliebener Moral in der sozialistischen Gesellschaft auch mit Hilfe des sozialistischen Rechts gelöst werden. Das heißt, kann die SED ihre Moralauffassung nicht gegen die Überzeugung der Bürger durchsetzen, so muß das sozialistische Recht, darunter zweifellos auch das sozialistische Strafrecht, eingesetzt werden. Das letzte Mittel ist also der Zwang geblieben.

VI. Die Staatsbürgerschaft der DDR
76 Art. 19 Abs. 4 verweist die Regelungen über die Bedingungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsbürgerschaft der DDR in die einfache Gesetzgebung. Schon vor dem Erlaß der Verfassung war das einschlägige Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik (Staatsbürgerschaftsgesetz) v. 20.2.1967 (GBl. DDR Ⅰ 1967, S. 3) ergangen.
1. Vorgeschichte
77 a) Die Verfassung von 1949 beschränkte sich auf die Festlegung in Art. 1 Abs. 4: »Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit.« Der Satz besagte zunächst, daß es keine eigene Staatsangehörigkeit der Länder geben sollte, die sich auf Deutschland als Ganzes bezog. Von einer besonderen Staatsangehörigkeit der DDR war damals noch nicht die Rede.
78 b) Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22.7.1913 (RGBl. S. 583) galt weiter, soweit es nicht partiell geändert war. Die Anordnung über die Gleichberechtigung der Frau im Staatsangehörigkeitsrecht vom 30.8.1954 (ZBl. S. 431) brachte, ohne daß, wie später in der Bundesrepublik [3. Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz v. 19.8.1957 (BGBl. BRD I 1957, S. 1251); Gesetz zur Änderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes v. 19.12.1963 (BGBl. BRD I 1963, S. 982)], das Gesetz vom 22.7.1913 geändert wurde, die Gleichstellung der Frau. Danach erwarb eine Ausländerin oder eine Staatenlose, die mit einem Deutschen die Ehe einging, durch die Eheschließung die deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr. Eine Deutsche, die mit einem Ausländer oder einem Staatenlosen die Ehe einging, verlor ihre deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr. Kinder, von denen eines der Elternteile deutscher Staatsangehöriger war, besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Verordnung über die Ausgabe von Personalausweisen der Deutschen Demokratischen Republik v. 29.10.1953 (GBl. DDR 1953, S. 1190) verwendete den Begriff »deutsche Staatsangehörige«. Ebenso verfuhren das Paß-Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik v. 15.9.1954 (GBl. DDR 1954, S. 786) und die Anordnung über die Gültigkeit von Ausweisen im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik v. 20.4.1956 (GBl. DDR Ⅰ 1956, S. 382). Die letztgenannte Anordnung verwendete außerdem die Begriffe »westdeutsche Bürger« und »westberliner Bürger«, ohne jedoch damit ausdrücken zu wollen, daß diese nicht deutsche Staatsangehörige wären. Erstmals im Konsulargesetz der DDR vom 22.5.1957 [Gesetz über den Aufbau und die Funktion der konsularischen Vertretungen der Deutschen Demokratischen Republik (Konsulargesetz) v. 22.5.1957, GBl. DDR Ⅰ 1957, Nr. 40 v. 1.7.1957, S. 313)] wurde die Bezeichnung »Bürger der DDR« gebraucht, obwohl es in § 19 von Anträgen auf Verleihung der »deutschen Staatsangehörigkeit« handelte. Dagegen ist in der Verordnung über das Verfahren in Staatsangehörigkeitsfragen v. 28.11.1957 (GBl. DDR Ⅰ 1957, S. 616) nur von »deutscher Staatsangehörigkeit« die Rede. Auch die Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Verfahren in Staatsangehörigkeitsfragen v. 28.1.1965 (GBl. DDR ⅠⅠ 1965, S. 143) bezog eine Änderung in dieser Beziehung nicht ein, obwohl dazu Gelegenheit bestanden hätte. Im Gesetz über die Wahlen zur Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am 16.11.1958 v. 24.9.1958 (GBl. DDR I 1958, S. 677) wurde die deutsche Staatsangehörigkeit zur Voraussetzung des aktiven und passiven Wahlrechts gemacht. Seit 1961 werden im Anschluß an das 30. Plenum des ZK der SED im Januar dieses Jahres in neuen, einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen die Bezeichnung »deutscher Staatsangehöriger« und der Begriff »deutsche Staatsangehörigkeit« nicht mehr verwendet. Es wird von »Bürgern der DDR einschließlich ihrer Hauptstadt (demokratisches Berlin)« in der Verordnung über den Besitz und die Verwendung von Personalausweisen v. 12.8.1961 (GBl. DDR ⅠⅠ 1961, S. 335) oder von »Bürgern der DDR« in der Zweiten Durchführungsbestimmung zum Paß-Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik v. 16.9.1963 (GBl. DDR ⅠⅠ 1963, S. 691) und in der Verordnung über die Personalausweise der Deutschen Demokratischen Republik - Personalausweisordnung - v. 23.9.1963 (GBl. DDR ⅠⅠ 1963, S. 700) gesprochen. Ebenso verfährt mit besonderem Nachdruck der Erlaß des Staatsrates über die Aufnahme von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik, die ihren Wohnsitz außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik haben, v. 21.8.1964 (GBl. DDR Ⅰ 1964, S. 128).
79 c) Diese Veränderungen in der Terminologie reflektieren einen Wandel der Auffassungen. Dieser vollzog sich gleichzeitig auf zwei Ebenen und betraf zunächst die Frage, welcher Staat die Staatsangehörigkeit vermittelt, und sodann die Qualität der Zugehörigkeit zur DDR. Im Jahre 1964 erklärte Gerhard Riege (Notwendigkeit und Inhalt eines Gesetzes über die Staatsbürgerschaft der DDR; Staatsbürgerschaft und nationale Frage), es handele sich bei dem Begriff »Bürger der DDR« lediglich um eine Präzisierung der Terminologie, die jetzt mit der Realität übereinstimme, nicht jedoch um eine Änderung der Rechtslage. Da die DDR mit ihrer Gründung Staatlichkeit erlangt habe, sei gleichzeitig auch eine Staatsbürgerschaft der DDR entstanden. Die Bezeichnung Staatsbürgerschaft anstelle Staatsangehörigkeit zeige einen qualitativen Unterschied. Die Qualität der Staatsbürgerschaft der DDR ergebe sich aus den Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Praxis. Aus ihnen folge, daß die Bürger in der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung eine prinzipiell andere Position einnähmen als in der kapitalistischen. Mit Blick auf die Entwicklung in Deutschland fügte er hinzu, wegen der Gesetzmäßigkeit des nationalen Kampfes der DDR habe die DDR-Staatsbürgerschaft die Eigenheit, bereits jetzt der Keim der künftigen einheitlichen deutschen Staatsbürgerschaft zu sein.
Damit wurde erstmals in der Öffentlichkeit die Ansicht vertreten, die »Staatsbürgerschaft der DDR« sei bereits im Jahre 1949 entstanden. Indessen fand diese Meinung damals (1964) noch nicht einhellige Zustimmung. Ingo Oeser (Martin Posch, Habilitationsverteidigung zum Thema »Die Staatsbürgerschaft der DDR«) vertrat den Standpunkt, erst mit »der Lösung Westdeutschlands aus dem deutschen Nationalverband« im Jahre 1955 durch die Pariser Verträge sei die besondere Staatsbürgerschaft der DDR entstanden. Prämisse dieser Ansicht war, daß die DDR erst 1955 Staatlichkeit erlangt habe. Diese Ansicht verträgt sich nicht mit dem heutigen Selbstverständnis der DDR (s. Rz. 1-27 zu Art. 1). Kritisch ist ferner zu bemerken: Da der Begriff der Staatsbürgerschaft an die Qualität der DDR als sozialistischer Staat anknüpft, im Jahre 1949 und auch im Jahre 1955 aber die DDR nach ihrem Selbstverständnis noch kein sozialistischer Staat war (s. Rz. 44 zur Präambel), hätte die Staatsbürgerschaft der DDR damals doch nichts anderes als eine Staatsangehörigkeit sein können.
Schon das zeigt, daß der Versuch, im Staatsangehörigkeitsrecht eine Unterscheidung nach der Qualität des Staates, zu dem die Zugehörigkeit besteht, vorzunehmen, fragwürdig und konsequent nicht durchzuführen ist. So ist es unter den angenommenen Prämissen inkonsequent, etwa von westdeutschen Bürgern oder von Bürgern der Bundesrepublik oder von Bürgern nichtsozialistischer Staaten zu sprechen. Jedoch geschieht das, z. B. regelmäßig in den Bestimmungen, die den Personenverkehr zwischen beiden Teilen Deutschlands oder den Transitverkehr zwischen der Bundesrepublik und Berlin-West regeln [Z. B. Vierte Durchführungsbestimmung zum Paß-Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik v. 1.12.1966 (GBl. DDR ⅠⅠ 1966, S. 855); Fünfte Durchführungsbestimmung zum Paß-Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik v. 11.6.1968 (GBl. DDR ⅠⅠ 1963, S. 331)] (s. Rz. 13, 14 zu Art. 7). Alexander N. Makarov (Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, S. 24) weist mit Recht darauf hin, daß der Terminus »Staatsbürgerschaft« im österreichischen und schweizerischen Recht statt des Begriffs »Staatsangehörigkeit« verwendet wird. Auch die Reichsverfassung von 1871 (Art. 4 Ziffer 1) verwendet die Formulierung »Staatsbürgerrechte«. Ursprünglich weist der Begriff also keineswegs auf eine besondere Qualität des Staates hin, zu dem die Staatsangehörigkeit besteht.
Wenn die Staatsangehörigkeit als eine rechtliche Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft eines Mitgliedes einer einen Staat bildenden Gebietskörperschaft, oder als Rechtsverhältnis zwischen dem Staat und der zu ihm gehörenden Einzelperson, innerhalb dessen die Eigenschaft der Einzelperson als Subjekt des Rechtverhältnisses einen rechtlichen Status dieser Person bildet, zu klassifizieren ist (Alexander N. Makarov, a.a.O., S. 13), so gilt für die Staatsbürgerschaft dasselbe.
Indessen hat die in der DDR vertretene spezifische Auffassung von der Staatsbürgerschaft gewisse Wirkungen auf die Gestaltung des Staatsangehörigkeitsrechts. Wenn Staatsbürgerschaft nicht nur als Zugehörigkeit zu einem Staat, sondern gleichzeitig auch als Eingeordnetsein in eine sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung angesehen wird, so bedeuten Erwerb und Verlust Einordnung in diese und Ausschluß aus dieser. Die Zugehörigkeit zum Staate ist gleichzeitig die Zugehörigkeit zur sozialistischen Gesellschaft. So werden die Regeln über den Erwerb und den Verlust inhaltlich davon bestimmt, unter welchen Bedingungen ein Mensch Mitglied einer konkreten sozialistischen Gesellschaft sein oder diese Eigenschaft verlieren kann. Diese Besonderheit betrifft zunächst nur das Verhältnis zum eigenen Staat. Im Verhältnis zu anderen Staaten und deren Staatsangehörigen ist die Zugehörigkeit zu einem Staat allein entscheidend. Im »Außenverhältnis« sind die Begriffe »Staatsangehörigkeit« und »Staatsbürgerschaft« daher synonym. Insofern ist Alexander N. Makarov zuzustimmen. Das »Innenverhältnis« berührt die Außenwelt zunächst nicht. Diese hat sich darum nicht zu kümmern. Indessen kann das »Innenverhältnis« nach außen strahlen. Das ist dann der Fall, wenn der sozialistische Staat für sich Menschen in Anspruch nimmt, die er zu seiner sozialistischen Gesellschaft rechnet, welche aber ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in dem Gebiet eines anderen Staates genommen und eine andere Staatsangehörigkeit haben. Für daraus entstehende Konflikte sind die Regeln des Völkerrechts anzuwenden, wie sie für die Inanspruchnahme von Menschen durch zwei oder mehr Staaten bestehen. Die Behauptung, die Staatsbürgerschaft eines sozialistischen Staates sei der Qualität nach mehr als eine Staatsangehörigkeit, ist für derartige Konfliktsituationen rechtlich irrelevant. Auch in solchen Fällen ist die Staatsbürgerschaft mit der Staatsangehörigkeit gleichzusetzen.
2. Das Entstehen der Staatsbürgerschaft der DDR
80 a) Das Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik (Staatsbürgerschaftsgesetz) v. 20.2.1967 (GBl. DDR Ⅰ 1967, S. 3) folgt den von Gerhard Riege entwickelten Vorstellungen. Im ersten Abschnitt der Präambel wird gesagt, daß mit der Gründung der DDR in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht die Staatsbürgerschaft der DDR entstanden sei. Sie sei Ausdruck der Souveränität der DDR und trage zur weiteren allseitigen Stärkung des sozialistischen Staates bei. Weil die Staatsangehörigkeit ein notwendiges Attribut jeder Staatlichkeit ist, ist die Präambel in der Form einer Deklaration abgefaßt. Trotzdem enthält sie ein konstitutives Element. Denn mit ihr hat sich der Gesetzgeber für das Entstehen der Staatsbürgerschaft der DDR mit dem Zeitpunkt der Gründung der DDR entschieden.
81 b) § 1 erklärt, wer Staatsbürger der DDR ist. Es werden drei Gruppen unterschieden. Hinsichtlich der beiden ersten Gruppen knüpft das Gesetz an die Gründung der DDR und die Eigenschaft als deutscher Staatsangehöriger (nach dem Gesetz vom 22.7.1913) an. Für die erste der beiden Gruppen (§ 1 Buchstabe a) ist Voraussetzung der Wohnsitz oder der ständige Aufenthalt in der DDR zum Zeitpunkt der Gründung der DDR (7.10.1949) in dieser Eigenschaft, wobei Berlin (Ost) als Teil der DDR behandelt wird (s. Rz. 79—81 zu Art. 1). Weitere Voraussetzung ist, daß die Staatsbürgerschaft der DDR seitdem nicht verlorengegangen ist. Damit nahm die DDR zunächst auch diejenigen Deutschen einschließlich ihrer Abkömmlinge für sich in Anspruch, die seit dem 7. 10. 1949 die DDR als Flüchtlinge oder freiwillig verlassen hatten und nach § 9 die Staatsbürgerschaft der DDR nicht durch Entlassung oder Aberkennung, also durch Mitwirkung der DDR-Behörden, verloren hatten [§ 1 Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik v. 3. 8. 1967 (GBl. DDR ⅠⅠ 1967, S. 681)].
Diesem völkerrechtswidrigen Verhalten wurde durch das Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsbürgerschaft v. 16.10.1972 (GBl. DDR Ⅰ 1972, S. 265) ein Ende gesetzt. Danach verloren DDR-Staatsbürger, die vor dem 1.1.1972 unter Verletzung der Gesetze des »Arbeiter-und-Bauern-Staates« die DDR verlassen und ihren Wohnsitz nicht wieder in der DDR genommen hatten, mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (am 17.10.1972) die Staatsbürgerschaft der DDR. Das gleiche gilt fiir die Abkömmlinge der genannten Personen, soweit sie »ohne Genehmigung der staatlichen Organe der Deutschen Demokratischen Republik« ihren Wohnsitz außerhalb der DDR haben.
82 Die zweite Gruppe (§ 1 Buchstabe b) umfaßt diejenigen, welche zum Zeitpunkt der Gründung der DDR deutsche Staatsangehörige waren, ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt aber außerhalb der DDR hatten. Diese sind dann Staatsbürger der DDR, wenn sie danach keine andere Staatsbürgerschaft erworben haben und entsprechend ihrem Willen durch Registrierung bei einem dafür zuständigen Organ der DDR als Bürger geführt werden. Wann diese Registrierung vorgenommen sein mußte, wird im Gesetz nicht gesagt. Sie kann also noch laufend erfolgen. Das ergibt sich auch aus § 2 der Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik v. 3. 8. 1967 (GBl. DDR ⅠⅠ 1967, S. 681), demzufolge die Registrierung als Bürger der DDR gemäß § 1 Buchstabe b des Gesetzes durch die zuständigen Auslandsvertretungen der DDR oder das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR erfolgt.
Unklarheiten bestehen darüber, ob unter diese Gruppe auch deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Bundesrepublik einschließlich Berlins (West) fallen. Diese haben keine andere Staatsbürgerschaft erworben, sondern ihre deutsche Staatsangehörigkeit behalten. Indessen werden sie von der DDR-Gesetzgebung als Bürger eines anderen Staates bzw. der »selbständigen politischen Einheit West-Berlin« behandelt [Vierte Durchführungsbestimmung zum Paß-Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik v. 1.12.1966 (GBl. DDR ⅠⅠ 1966, S. 855); Fünfte Durchführungsbestimmung zum Paß-Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik v. 11.6.1968 (GBl. DDR ⅠⅠ 1963, S. 331)]. Es läge vom Standpunkt der DDR her daher nahe, diese Deutschen als solche anzusehen, die eine andere Staatsbürgerschaft erworben haben. Freilich wäre dieser Erwerb nicht nach der Gründung der DDR, sondern vorher mit der Gründung der Bundesrepublik (20.9.1949 - Abschluß der Bildung der obersten Bundesorgane) erfolgt, soweit es sich um Deutsche mit Wohnsitz in der Bundesrepublik handelt. Ebenfalls vorher wäre die Eigenschaft als Bürger der selbständigen politischen Einheit West-Berlin erworben. Die Entstehung einer selbständigen politischen Einheit müßte auf den Zeitpunkt der administrativen Spaltung der Stadt im Jahre 1948 datiert werden. Praktisch verhalten sich die Behörden der DDR jedoch ohne erkennbare Rechtsgrundlage nach wie vor so, daß sie Übersiedlern aus der Bundesrepublik und Berlin (West) auf Antrag nach einer Überprüfung einen Personalausweis aushändigen und sie damit als Staatsbürger der DDR behandeln.
83 Die dritte Gruppe (§ 1 Buchstabe c) umfaßt diejenigen, die die Staatsbürgerschaft der DDR erworben und sie seitdem nicht verloren haben. Dazu erläutert § 3 Durchführungsverordnung, daß die Staatsbürgerschaft gemäß § 1 Buchstabe c des Gesetzes durch die Aushändigung einer von den zuständigen staatlichen Organen der DDR ausgestellten Einbürgerungsurkunde oder des für Bürger der DDR bestimmten Personalausweises erworben wurde. Damit sind diejenigen, die vor oder nach der Gründung der DDR, ob sie nun deutsche Staatsangehörige waren oder nicht, eine Einbürgerungsurkunde oder einen Personalausweis erhalten hatten, Staatsbürger der DDR. Es handelt sich bei diesen vor allem um die aus dem Osten Europas oder den ehemaligen deutschen Ostgebieten Vertriebenen oder Geflüchteten - im Sprachgebrauch der DDR »Umsiedler« genannt. Diesen Personen wurde der Personalausweis der DDR ausgehändigt wie denen, die ihren Wohnsitz schon immer in der DDR hatten (Gerhard Riege, Die Staatsbürgerschaft der DDR, S. 213; Ingo Oeser, Völkerrechtliche Grundfragen der Entstehung und Regelung der Staatsbürgerschaft der DDR ...).
3. Der Inhalt der Staatsbürgerschaft
84 a) Der zweite Satz der Präambel des Staatsbürgerschaftsgesetzes der DDR bringt den angeblich qualifizierten Inhalt der Staatsbürgerschaft zum Ausdruck. Es wird erklärt, daß diese die Zugehörigkeit ihrer Bürger »zum ersten friedliebenden, demokratischen und sozialistischen deutschen Staate« sei, in dem die Arbeiterklasse die politische Macht im Bündnis mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, der sozialistischen Intelligenz und den anderen werktätigen Schichten ausübe.
85 b) § 2 Abs. 1 charakterisiert die besondere Qualität der Staatsbürgerschaft der DDR. Danach garantiert diese den Bürgern die Wahrnehmung der verfassungsmäßigen Rechte-nach Erlaß der Verfassung von 1968 also die Rechte aus dieser - und fordert von ihnen die Erfüllung der verfassungsmäßigen Pflichten. Damit wird auch der Grund erkennbar, aus dem die verfassungsrechtlichen Bestimmungen über das Staatsbürgerschaftsrecht, wenn auch nur in der Form einer Verweisung auf die einfache Gesetzgebung, in den Art. 19 aufgenommen wurden, der die wesentlichen Züge der Grundrechtskonzeption der Verfassung enthält - im Unterschied zur Verfassung von 1949, die den Satz über die eine deutsche Staatsangehörigkeit in Art. 1 enthielt, der den Abschnitt über die Grundlagen der Staatsgewalt einleitete.
Bedeutungsvoll ist, daß auch die Staatsbürger der DDR in Pflicht genommen werden, die ihren Wohnsitz außerhalb der DDR haben, darunter vor allem diejenigen, welche in die Bundesrepublik einschließlich Berlin (West) seit dem 1.1.1972 geflüchtet sind, sowie deren Abkömmlinge (§ 6, s. Rz. 81 zu Art. 19). Dazu führte Gerhard Riege (Die staatsrechtliche Stellung des Bürgers in der DDR) im Anschluß an den Erlaß des Staatsrates über die Aufnahme von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik, die ihren Wohnsitz außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik haben, v. 21.8.1964 (GBl. DDR Ⅰ 1964, S. 128) aus, die Möglichkeiten des republikflüchtigen Bürgers, aktiv am sozialistischen Aufbau mitzuwirken, seien naturgemäß eingeschränkt. Die Treuepflicht, die der Bürger zu seinem Staate habe, gewinne jedoch gerade dann besonderes Gewicht, wenn er nicht in seinem Heimatstaate lebe. Um wieviel bedeutender sei sie, wenn er sich in einem Staate aufhalte, dessen erklärtes Ziel es sei, die DDR zu beseitigen. Man möge einwenden, daß sich unter denen, die die DDR verlassen hätten, nicht wenige befänden, die gegenüber der DDR keine Pflichten erfüllen wollten. Das ändere jedoch nichts daran, daß auch diese »ungeratenen oder irrenden Kinder ihrem Elternhaus gegenüber verpflichtet seien, selbst wenn sie es nicht wissen oder wahrhaben sollten«. Er verlangte von den Flüchtlingen, daß sie für Entspannung, für die Erhaltung des Friedens, gegen Revanchepolitik und Militarismus einträten, ferner für die gegenseitige Anerkennung der beiden deutschen Staaten, für die Entwicklung der Demokratie und für soziale Sicherheit, gegen die Diktatur der Monopole sowie für antifaschistisch-demokratische Veränderungen in der Bundesrepublik. Gerhard Riege bezeichnete diese Pflichten ausdrücklich als Rechtspflichten, die durch staatliche Mittel erzwungen werden könnten.
Nach § 2 Abs. 2 gewährt die DDR - gleichsam als Gegenstück zur Inpflichtnahme - ihren Bürgern Schutz und unterstützt sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte außerhalb der DDR. Diese Bestimmung hat in einer modifizierten Fassung Aufnahme in Art. 33 Abs. 1 (s. Rz. 1-9 zu Art. 33) gefunden.
4. Doppelte oder mehrfache Staatsbürgerschaft
86 § 3 befaßt sich mit der doppelten oder mehrfachen Staatsbürgerschaft (Staatsangehörigkeit).
87 a) Die in der DDR vertretene Konzeption von der Staatsbürgerschaft ist doppelten oder mehrfachen Staatsbürgerschaften gegenüber noch abweisender als das Staatsangehörigkeitsrecht im allgemeinen, das darauf sieht, unerwünschte Folgen einer doppelten oder mehrfachen Staatsangehörigkeit zu vermeiden. Weil die Staatsbürgerschaft eines sozialistischen Staates die Zugehörigkeit zu der sozialistischen Gesellschaft einschließt, deren Organisation ein bestimmter sozialistischer Staat ist, ist kaum vorstellbar, daß ein Mensch gleichzeitig zu einer sozialistischen Gesellschaft und einem Staat gehört, der eine nichtsozialistische Gesellschaftsordnung hat. Aber auch die Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen sozialistischen Staaten bereitet Unbehagen. Denn solange sozialistische Gesellschaften in verschiedenen Staaten organisiert sind, bestehen trotz der gemeinsamen Zugehörigkeit der Staaten zum sozialistischen Lager unterschiedliche Loyalitäten. Weil das Mitglied einer sozialistischen Gesellschaft sich grundsätzlich nicht aus eigenem Willen aus dieser lösen darf (s. Rz. 92 zu Art. 19) und eine doppelte oder mehrfache Staatsbürgerschaft (Staatsangehörigkeit) unklare Loyalitätsverhältnisse schafft, ist es konsequent, den Erwerb einer anderen Staatsbürgerschaft von der Mitwirkung der Staatsorgane der DDR abhängig zu machen. Im Gegensatz zur Regelung des § 25 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22.7.1913, die davon ausgeht, daß der Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit im Willen des deutschen Staatsangehörigen steht, aber vorsieht, daß unter gewissen Voraussetzungen der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eintritt, es sei denn, es wird auf Antrag die Genehmigung zur Beibehaltung erteilt, bedarf ein Staatsbürger der DDR, der die Staatsbürgerschaft eines anderen Staates zu erwerben beabsichtigt, nach § 3 Abs. 2 dazu der Zustimmung der zuständigen Organe der DDR. Die Zustimmung zur Annahme einer anderen Staatsbürgerschaft ist in das Ermessen der staatlichen Organe gestellt, das sie nach marxistisch-leninistischer Lehre entsprechend den Erfordernissen der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung auszuüben haben. Zum Verfahren bestimmt § 4 der Durchführungsverordnung: Zuständig für die Zustimmung ist grundsätzlich das Ministerium des Innern. Bürger, die ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt außerhalb der DDR haben und beabsichtigen, eine andere Staatsangehörigkeit zu erwerben, können den Antrag bei einer Auslandsvertretung der DDR oder beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR stellen. Bürger, die ihren Wohnsitz in der DDR haben, können den Antrag bei dem für den Wohnsitz zuständigen Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, stellen, wenn die Genehmigung der dafür zuständigen staatlichen Organe vorliegt, den Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt außerhalb der DDR zu nehmen.
Nach § 18 Abs. 1 Rechtsanwendungsgesetz [Gesetz über die Anwendung des Rechts auf internationale zivil-, familien- und arbeitsrechtliche Beziehungen sowie auf internationale Wirtschaftsverträge - Rechtsanwendungsgesetz - v. 5.12.1975 (GBl. DDR Ⅰ 1975, S. 748); zuvor: § 15 Abs. 1 Einführungsgesetz zum Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik v. 20.12.1965 (GBl. DDR Ⅰ 1966, S. 19] muß ein Staatsbürger der DDR, der mit einem Staatsbürger eines anderen Staates die Ehe eingehen will, dazu die Zustimmung der zuständigen staatlichen Organe der DDR haben. Für Bürger der DDR, die infolge der Eheschließung nach dem Recht des anderen Staates zusätzlich eine andere Staatsbürgerschaft erwerben, gilt die Zustimmung zur Eheschließung als Zustimmung nach § 3 Abs. 2 Staatsbürgerschaftsgesetz. Mit dem Erwerb einer anderen Staatsbürgerschaft durch Bürger der DDR tritt ein Verlust der Staatsbürgerschaft der DDR nicht ein.
Trotz der Erschwerung des Erwerbs einer anderen Staatsbürgerschaft können doppelte Staatsbürgerschaften also nicht in jedem Falle vermieden werden. Das gilt auch für folgenden Fall: Wenn ein Kind eines DDR-Staatsbürgers auf dem Hoheitsgebiet eines Staates geboren wird, der dem ius soli folgt (vgl. die Aufstellung bei Alexander N. Makarov, S. 47), so hat das Kind sowohl die Staatsbürgerschaft der DDR (§ 4 Buchstabe a Staatsbürgerschaftsgesetz, s. Rz. 91 zu Art. 19) als auch die Staatsangehörigkeit des Staates, auf dessen Hoheitsgebiet es geboren wurde. Da derartige Fälle nicht durch innerstaatliches Recht gelöst werden können, fehlen dazu auch Regelungen im Staatsbürgerschaftsgesetz der DDR.
88 b) Für alle Fälle doppelter oder mehrfacher Staatsbürgerschaft gilt § 3 Abs. 1 Staatsbürgerschaftsgesetz. Danach können Staatsbürger der DDR nach allgemein anerkanntem Völkerrecht gegenüber der DDR keine Rechte oder Pflichten aus einer anderen Staatsbürgerschaft geltend machen. Die DDR kann ihre Staatsbürger, auch wenn sie noch eine oder mehrere andere Staatsbürgerschaften haben, so behandeln, als ob sie nur die Staatsbürgerschaft der DDR hätten.
89 c) Nach § 3 Abs. 3 Staatsbürgerschaftsgesetz finden Regelungen zu Fragen der Staatsbürgerschaft, die in zwischenstaatlichen Vereinbarungen der DDR mit anderen Staaten getroffen werden, Anwendung. Durch diese Transformation völkerrechtlichen Vertragsrechts in innerstaatliches Recht ist die Möglichkeit geschaffen, in solchen Vereinbarungen Regelungen zu treffen, die vom Gesetz abweichen.
Das ist geschehen in den Verträgen zwischen der DDR und der UdSSR, der Ungarischen Volksrepublik, der Volksrepublik Bulgarien, der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, der Volksrepublik Polen, der Mongolischen Volksrepublik und Rumänien [UdSSR v. 11.4.1969 (GBl. DDR I 1969, S. 108); Ungarn v. 17.12.1969 (GBl. DDR I 1970, S. 25); Bulgarien v. 1.10.1971 (GBl. DDR I 1972, S. 82); CSSR v. 10.10.1973 (GBl. DDR II 1973, S. 273); Polen v. 12.11.1975 (GBl. DDR II 1976, S. 102); Mongolei v. 6.5.1977 (GBl. DDR II 1977, S. 275); Rumänien v. 20.4.1979 (GBl. DDR II 1980, S. 49)].
Diese Verträge zielen darauf ab, doppelte Staatsbürgerschaften zu beseitigen. Ihnen zufolge können Personen, die beide Vertragspartner als ihre Bürger betrachten, sich für die Staatsbürgerschaft einer der beiden Vertragspartner entscheiden. Die Möglichkeit einer Option, die das Staatsbürgerschaftsgesetz nicht kennt (s. Rz. 91 zu Art. 19), wurde hier ausnahmsweise deshalb eingeräumt, weil beide Staaten eine sozialistische Gesellschaftsund Staatsordnung haben. Die Möglichkeit einer derartigen Option hatte bereits Gerhard Riege (Notwendigkeit und Inhalt ..., S. 482) bei Kollisionen mit sozialistischen Ländern empfohlen. Die Option ist innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Inkrafttreten des jeweiligen Vertrages zu erklären. Wird während der gesetzten Frist von der Möglichkeit der Option nicht Gebrauch gemacht, tritt automatisch der Verlust einer Staatsbürgerschaft ein. Betroffene werden Staatsbürger des Vertragspartners, auf dessen Hoheitsgebiet sie zu diesem Zeitpunkt ihren Wohnsitz haben bzw. vor der Ausreise in einen dritten Staat hatten.
5. Erwerb und Verlust der Staatsbürgerschaft
90 Die Erwerbs- und Verlusttatbestände des Staatsbürgerschaftsgesetzes sind so gefaßt, daß der Wille des einzelnen weitgehend unbeachtet bleibt und dort, wo es auf ihn ankommt, die Mitwirkung der staatlichen Organe der DDR zur Veränderung des Status notwendig ist. Das entspricht der Konzeption, derzufolge die Zugehörigkeit zu einer sozialistischen Gesellschaft unabhängig vom Willen des einzelnen ist.
91 a) Das Gesetz kennt drei Tatbestände für den Erwerb der Staatsbürgerschaft:
- die Abstammung,
- die Geburt auf dem Territorium der DDR,
- die Verleihung (§ 4).
Für die Kinder von DDR-Staatsbürgern, und das bedeutet auch für die Kinder der folgenden Generationen, gilt ohne Einschränkung das ius sanguinis (§ 5). Es genügt, daß ein Elternteil Staatsbürger der DDR ist. Tritt wegen der Staatsangehörigkeit des anderen Elternteils damit eine doppelte Staatsangehörigkeit ein, so wird das vom Gesetz in Kauf genommen. Damit folgt es dem § 3 der Anordnung vom 30.8.1954 (ZBl. S. 431). Jedoch sah dessen Satz 2 eine Optionsmöglichkeit in einer späteren gesetzlichen Regelung vor, die aber niemals erging. (Wegen der Option im Falle einer doppelten Staatsbürgerschaft aufgrund von Staatsverträgen s. Rz. 89 zu Art. 19.) Subsidär gilt das Territorialitätsprinzip. Die Staatsbürgerschaft der DDR wird erworben, wenn ein Kind auf dem Territorium der DDR geboren wird und durch seine Geburt eine andere Staatsbürgerschaft nicht erworben hat (§ 6 Abs. 1). Damit wird eine Staatenlosigkeit vermieden. Gerhard Riege (Die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik, S. 273) hatte dazu die Ansicht vertreten, daß ein in die sozialistischen Gesellschaftsverhältnisse hineingeborenes und in ihnen aufwachsendes Kind in die Staatsbürgerschaft aufgenommen werden müsse. Auch ein auf dem Territorium der DDR aufgefundenes Kind (Findelkind) erwirbt die Staatsbürgerschaft der DDR, wenn eine andere Staatsbürgerschaft nicht nachgewiesen werden kann (§ 6 Abs. 2). Durch Eheschließung wird die Staatsbürgerschaft der DDR nicht erworben. Das Gesetz folgt damit der Regelung der Anordnung über die Gleichberechtigung der Frau im Staatsangehörigkeitsrecht vom 30.8.1954 (ZBl. S. 431) (s. Rz. 78 zu Art. 19).
Die Verleihung ersetzt die Einbürgerung. Sie setzt einen Antrag, also eine Willenserklärung voraus. Die Verleihung kann vorgenommen werden, wenn der Antragsteller »sich durch sein persönliches Verhalten und durch seine Einstellung zur Staats- und Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen Republik der Verleihung der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik würdig erweist und der Verleihung keine zwingenden Gründe entgegenstehen«. Der Antragsteller soll in der Regel seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in der DDR haben. Zwingend ist diese Voraussetzung also nicht. Über die Verleihung wird eine Urkunde ausgehängt (§ 7).
Auf die Verleihung besteht kein Rechtsanspruch, auch nicht für die Ehefrau mit anderer Staatsangehörigkeit oder im Status der Staatenlosigkeit, die einen Staatsbürger der DDR geheiratet hat - letzteres im Gegensatz zu § 2 Abs. 2 Anordnung vom 30.8.1954.
Die Verleihung steht im Ermessen des zuständigen staatlichen Organs der DDR, das entsprechend den Erfordernissen der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung auszuüben ist. Die Verleihung kann vom Nachweis der Entlassung aus einer anderen Staatsbürgerschaft abhängig gemacht werden [§7 Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik v. 3. 8. 1967 (GBl. DDR ⅠⅠ 1967, S. 681)]. (Wegen der Zuerkennung der Staatsbürgerschaft der DDR an Übersiedler aus der Bundesrepublik oder Berlin [West] s. Rz. 82 zu Art. 19).
Die Verleihung erstreckt sich auf Minderjährige, wenn der Antrag auch für sie gestellt wird. Der Antrag nur eines Elternteils genügt. Hat der Minderjährige das 14. Lebensjahr vollendet, ist seine Einwilligung erforderlich (§ 8). Da in der DDR die Volljährigkeit mit der Vollendung des 18. Lebensjahres beginnt [§ 49 ZGB; zuvor: Gesetz über die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters v. 17.5.1950 (GBl. DDR 1950, S. 437)], kann ein selbständiger Antrag von diesem Zeitpunkt an gestellt werden.
Die Möglichkeit, durch Option die Staatsbürgerschaft der DDR zu erwerben, sieht das Gesetz nicht vor.
92 b) Das Gesetz kennt drei Verlusttatbestände:
- die Entlassung,
- den Widerruf der Verleihung,
- die Aberkennung (§ 9).
Das Gesetz kennt also weder den Tatbestand des Verzichts auf die Staatsbürgerschaft noch den automatischen Verlust der Staatsbürgerschaft. Die Entscheidung, ob ein Staatsbürger der DDR seinen Status behält oder nicht, liegt allein in den Händen der staatlichen Organe der DDR. (Wegen des Verlustes der Staatsbürgerschaft der DDR bei doppelter Staatsbürgerschaft durch Option oder durch Nichtausübung der Option aufgrund von Staatsverträgen s. Rz. 89 zu Art. 19).
Die Entlassung setzt voraus, daß a) ein Antrag gestellt wird, b) der Antragsteller seinen Wohnsitz mit Genehmigung der zuständigen staatlichen Organe außerhalb der DDR hat oder nehmen will, c) er eine andere Staatsbürgerschaft besitzt oder zu erwerben beabsichtigt, d) der Entlassung aus der Staatsbürgerschaft keine zwingenden Gründe entgegenstehen. Über die Entlassung wird eine Urkunde ausgehändigt (§ 10). Die Entlassung ist eine Ermessensfrage, über die entsprechend den Erfordernissen der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung zu entscheiden ist.
Die Entlassung erstreckt sich auf die minderjährigen Kinder, wenn der Antrag der Eltern auch für sie gestellt wird. Wird der Antrag nur von einem Elternteil gestellt, ist der andere Eltemteil zu hören. Hat der Minderjährige das 14. Lebensjahr vollendet, ist seine Einwilligung erforderlich (§11).
Der Widerruf einer Verleihung ist möglich, wenn bei der Antragstellung falsche Angaben gemacht wurden oder Tatsachen verschwiegen wurden, die die Verleihung ausgeschlossen hätten (fehlerhafter Verwaltungsakt), oder sich der Bürger durch grobe Mißachtung der mit der Verleihung übernommenen Verpflichtungen der Verleihung nicht würdig erweist. Der Widerruf ist nur innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren nach der Verleihung zulässig (§ 12).
Die Aberkennung der Staatsbürgerschaft kann erfolgen, wenn ein Bürger, der seinen Wohnsitz oder Aufenthalt außerhalb der DDR hat, sich »grober Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten« schuldig macht (§ 13). Damit folgt das Gesetz dem § 1 Abs. 3 des Erlasses des Staatsrates über die Aufnahme von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik, die ihren Wohnsitz außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik haben, v. 21.8.1964 (GBl. DDR Ⅰ 1964, S. 128). Der Widerruf der Verleihung und die Aberkennung wirken nur gegen die Personen, gegen die der Widerruf oder die Aberkennung ausgesprochen wurde, also nicht gegen Abkömmlinge (§ 14).
Zutreffend stellt Gottfried Zieger (Das Staatsbürgerschaftsgesetz der DDR, S. 21) fest, daß, vom Falle des fehlerhaften Verwaltungsaktes abgesehen, die Hereinnahme der Aberkennung und des Widerrufs von Verleihungen in die Tatbestände, die einen Verlust der Staatsbürgerschaft bewirken, ein bedauerliches Zurückgreifen auf eine von der Völkerrechtsgemeinschaft getadelte Praxis der NS-Zeit [Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit v. 14.7.1933 (RGBl. I, S. 480)] ist.
Rechtsentwicklung bis zur Wende im Herbst 1989: Durch die Verordnung zu Fragen der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik v. 21.6.1982 (GBl. DDR Ⅰ 1982, S. 418) war den Deutschen, welche die DDR vor dem 1.1.1981 ohne Genehmigung verlassen hatten und nicht wieder zurückgekehrt waren, sowie deren außerhalb der DDR lebenden Abkömmlingen mit Ausnahme der “Fahnenflüchtigen“ die Staatsbürgerschaft der DDR aberkannt worden. Nach dem Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsbürgerschaft v. 16.10.1972 (GBl. DDR Ⅰ 1972, S. 265) galt das bereits für alle vor dem 1.1.1972 geflüchteten Deutschen (Einzelheiten in ROW 5/1982, S. 215).
93 c) Das Gesetz (G) enthält nur wenige Bestimmungen über die Zuständigkeit und das Verfahren. Ergänzende Bestimmungen enthält die Durchführungsverordnung (DVO) zum Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik v. 3. 8. 1967 (GBl. DDR ⅠⅠ 1967, S. 681).
Über die Verleihung und die Entlassung entscheidet der Ministerrat der DDR. Dieser kann die Entscheidungsbefugnis delegieren (§ 15 Abs. 1 und 2 G). Anträge werden nach § 17 G durch die vom Ministerium des Innern bzw. Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten beauftragten Dienststellen entgegengenommen. Nach § 5 DVO ist der Antrag auf Verleihung bei dem für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Rat des Kreises, Abteilung Innere Angelegenheiten, einzureichen. Hat der Antragsteller seinen Wohnsitz außerhalb der DDR, ist der Antrag bei der zuständigen Auslandsvertretung der DDR oder beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR zu stellen. Wird der Antrag für Minderjährige mitgestellt, so sind diese im Antrag aufzuführen. Ein Antrag für Minderjährige ist durch die Eltern, ein Elternteil oder einen anderen gesetzlichen Vertreter zu stellen. § 6 DVO legt fest, welche Unterlagen dem Antrag beizufügen sind. Für den Antrag auf Entlassung gelten entsprechende Bestimmungen (§§ 8-10 DVO). Die Entlassungsurkunde wird durch die zuständige Auslandsvertretung der DDR oder, wenn die Genehmigung dafür erteilt ist, den Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt außerhalb der DDR zu nehmen, durch den zuständigen Rat des Kreises ausgehändigt (§11 Abs. 1 DVO). Die Verleihung und die Entlassung werden mit der Aushändigung der Urkunde wirksam (§15 Abs. 3 G). Soweit eine persönliche Aushändigung nicht möglich ist, wird die Entlassung mit der Zustellung der Urkunde wirksam (§11 Abs. 2 DVO).
Für den Widerruf der Verleihung und die Aberkennung ist der Ministerrat der DDR zuständig (§ 16 Abs. 1 G). Hier ist eine Delegation nicht vorgesehen. Das unterstreicht den exzeptionellen Charakter und die politische Bedeutung dieser Akte (so auch Gottfried Zieger, Das Staatsbürgerschaftsgesetz der DDR, S. 21/22).
Der Widerruf der Verleihung und die Aberkennung werden bereits mit der Entscheidung wirksam. Eine Veröffentlichung oder eine Zustellung an den Betroffenen ist nicht vorgesehen. Verfahrensvorschriften fehlen.
94 d) Bürgern der DDR, die aus begründetem Anlaß einen gesonderten Nachweis über die Staatsbürgerschaft der DDR benötigen, kann ein solcher auf ausführlich begründeten Antrag vom Ministerium des Innern ausgestellt werden (§ 12 DVO).
6. Das Verhältnis des Staatsbürgerschaftsgesetzes zu den Verfassungen von 1949 und 1968/1974
95 Das Staatsbürgerschaftsgesetz vom 20.2.1967 konnte nur dann mit Art. 1 Abs. 4 Verfassung vom 1949 als im Einklang befindlich angesehen werden, wenn die eine Staatsangehörigkeit im Sinne dieses Verfassungssatzes in die Staatsangehörigkeit der DDR umgedeutet wurde. Dazu bestand aber in Anbetracht seines klaren Wortlauts keine Möglichkeit. Trotz der Verfassungswidrigkeit hatte das Gesetz aber Wirksamkeit erlangt.
Weil die Verfassung von 1968/1974 von der Eigenstaatlichkeit der DDR ausgeht und in Art. 19 Abs. 4 sogar auf die einfache Gesetzgebung verweist, liegt Verfassungswidrigkeit des Gesetzes nunmehr nicht vor.
7. Das Verhältnis der Staatsbürgerschaft der DDR zur Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland
96 a)Die divergierenden Auffassungen. Die Bundesrepublik Deutschland hält an der Einheitlichkeit der deutschen Staatsangehörigkeit fest. Diese Haltung beruht nicht nur auf einer politischen Entscheidung, sondern folgt vor allem aus dem Grundgesetz. Die DDR strebt danach, die Bundesrepublik von dieser Einstellung abzubringen. Anläßlich der Unterzeichnung des Vertrages über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland vom 21.12.1972 (Grundlagenvertrag) erklärte die DDR in einem Protokollvermerk: »Die Deutsche Demokratische Republik geht davon aus, daß der Vertrag eine Regelung der Staatsangehörigkeitsfragen erleichtern wird« [Zusatzprotokoll zum Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland (Grundlagenvertrag) v. 21.12.1972, GBl. DDR ⅠⅠ 1973, S. 27)]. Die Bundesrepublik Deutschland erklärte dazu: »Staatsangehörigkeitsfragen sind durch den Vertrag nicht geregelt worden« (BGBl. BRD II 1973, S. 426). Das Bundesverfassungsgericht erklärte in einem Leitsatz zum Grundlagenurteil vom 31.7.1973 (BVerfGE 36, S. 1=NJW 1973, S. 1539 = ROW 1973, S. 226):
»Art. 16 GG geht davon aus, daß die >deutsche Staatsangehörigkeit, die auch in Art. 116 Abs. 1 GG in Bezug genommen ist, zugleich die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland ist. Deutscher Staatsangehöriger im Sinne des Grundgesetzes ist also nicht nur der Bürger der Bundesrepublik Deutschland.«
Diese Divergenz in den Auffassungen der beiden Staaten in Deutschland erschwert den Abschluß mancher Folgeabkommen zum Grundlagenvertrag, besonders eines Rechtshilfeabkommens, bei dem es auf eine Präzision der Staatsangehörigkeit der betroffenen Personen ankommt.
97 b) Ob und wie das Staatsbürgerschaftsgesetz von der Rechtsordnung der Bundesrepublik aufgenommen werden soll, sind Fragen, die unterschiedlich beantwortet werden.
Weil die Frage der Staatsbürgerschaft von der Frage der Staatlichkeit eines Gemeinwesens abhängt, reflektieren die Antworten die Ansichten über die Staatlichkeit der DDR. Gottfried Zieger (Das Staatsbürgerschaftsgesetz der DDR) unterscheidet drei Hauptgruppen von Meinungen: 1) die These von der Unbeachtlichkeit des Gesetzes, die von der Bundesregierung im Jahre 1967 vertreten wurde, von Dieter Schröder (Die völkerrechtliche Wirkung des »Gesetzes über die Staatsbürgerschaft der DDR«), der das Gesetz als Recht einer im latenten Bürgerkrieg befindlichen Partei ansah, und Fritz Wittmann (Rechtsfragen zum Staatsbürgergesetz) geteilt wird und sich insbesondere auf die Einheitlichkeit des deutschen Staatsvolkes stützt sowie auf die Unvereinbarkeit des Gesetzes mit dem Potsdamer Abkommen verweist, 2) die These von der Hinnahme oder Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft, die aus der Zweistaatentheorie folgt und vor allem von denen geteilt wird, die für die völkerrechtliche Anerkennung der DDR plädieren, 3) eine Anzahl von Mittelmeinungen. Als solche sind zu nennen: a) die These von einer Teilordnungszugehörigkeit (Dieter Blumenwitz, Das neue Staatsbürgerschaftsgesetz der DDR), b) die These von einer dreigliedrigen deutschen Staatsangehörigkeit (Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Teilung Deutschlands und die deutsche Staatsangehörigkeit), c) die These von der Umdeutung der DDR-Staatsbürgerschaft in die deutsche Staatsangehörigkeit (Rudolf Bernhardt im Bericht des Königsteiner Kreises).
98 Gegen die These von der Unbeachtlichkeit war stets einzuwenden, daß die DDR nicht davon abgehalten werden kann, das Gesetz in ihrem Gebiet anzuwenden und die Staatsangehörigkeit mit Wirkung für die ihrer Personalhoheit unterliegenden Personen nach diesen Regeln abweichend von den im Bundesgebiet geltenden zu ordnen. Das gilt insbesondere nach Abschluß des Grundlagenvertrages. In irgendeiner Weise müßte die Rechtsordnung der Bundesrepublik also doch reagieren, um Konfliktsituationen zu bewältigen. Das könnte der Verwaltung überlassen bleiben. Doch würde dann die Gefahr recht unterschiedlicher Praxis entstehen. Würde man die Lösung einer reaktiven Gesetzgebung überlassen, wie Ulrich Drobnig (Bericht des Königsteiner Kreises) vorschlägt, würde eine Abhängigkeit der Gesetzgebung der Bundesrepublik von den Rechtssetzungsakten der DDR entstehen, die kaum erträglich erscheint.
99 Die Hinnahme des Staatsbürgerschaftsgesetzes würde - sieht man von der Frage der wohl implizite damit ausgesprochenen Anerkennung der DDR als Völkerrechtssubjekt einmal ab, die freilich Karl Doehring (Die Teilung Deutschlands als Problem des völker-und staatsrechtlichen Fremdenrechts) nicht für eine zwingende Folge hält - die Ausgliederung der in der DDR wohnenden Deutschen aus der deutschen Staatsangehörigkeit bedeuten.
100 Gegen die These von der Teilordnungszugehörigkeit spricht, daß sie auf die bis 1934 geltende Fassung des § 1 des Gesetzes vom 22.7.1913 zurückgreift, nach dem Deutscher war, der die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat oder die unmittelbare Reichszugehörigkeit hatte. Das erscheint mißlich. Auch wären die praktischen Schwierigkeiten nicht unbedeutend.
101 Die These von der dreigliedrigen deutschen Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik, Staatsangehörigkeit der DDR, die ruhende Staatsangehörigkeit Gesamtdeutschlands) berücksichtigt nicht die besondere Situation Berlins. Ihr zufolge müßten die Berliner die einzigen Träger der ruhenden gesamtdeutschen Staatsangehörigkeit sein, weil wegen des Status der Stadt der Verselbständigungsprozeß der deutschen Staatsgewalt dort nicht zu der Stufe gediehen ist, die in der Bundesrepublik und in der DDR schon 1954/1955 erreicht wurde, bis zu welchem Zeitpunkt Ernst-Wolfgang Böckenförde die deutsche Staatsangehörigkeit noch primär gelten läßt.
102 Trotzdem bieten die Mittelmeinungen einen fruchtbaren Ansatz. Gottfried Zieger (Das Staatsbürgerschaftsgesetz der DDR, S. 55 ff.) bietet eine Lösung an, die der Umdeutungslehre Rudolf Bernhardts entspricht, diese jedoch sublimiert. Es ist davon auszugehen, daß die deutsche Frage zur Zeit noch in der Schwebe ist (s. Rz. 67-69 zu Art. 1). Von einer restlosen Auflösung der deutschen Einheit kann nicht die Rede sein. Trotzdem ist zu berücksichtigen, daß sich in der DDR eine effektive Gesetzgebungsgewalt entwickelt hat.
Gottfried Zieger interpretiert das Staatsbürgerschaftsgesetz als eine Art Neufassung des Gesetzes vom 22.7.1913. Er nimmt wie Rudolf Bernhardt eine Umdeutung vor. Die Staatsbürgerschaft der DDR würde damit die deutsche Staatsangehörigkeit vermitteln. Ziegers Vorschlag vermeidet die Gefahr einer völkerrechtlichen Anerkennung der DDR durch die Bundesrepublik Deutschland, die den Schwebezustand der deutschen Frage beenden würde.
Die Beachtlichkeit des Staatsbürgerschaftsgesetzes hat für die Rechtsordnung der Bundesrepublik aber dort ihre Grenze, wo dieses anfängt, gegen deren ordre public zu verstoßen. Dabei ist zu beachten, daß der ordre public der Bundesrepublik sich nicht gegen die Rechtsordnung der DDR als Ganzes richtet, sondern nur gegen Regelungen der DDR, die sich nicht mit der Aufrechterhaltung der deutschen Einheit, mit der Existenz der Bundesrepublik oder mit ihrer inneren Ordnung vereinbaren lassen. Schwierigkeiten in der Verwaltungspraxis werden sich freilich auch einstellen, wenn diesem Vorschlag gefolgt wird. Zieger schätzt diese aber als geringer ein, als wenn die These von der Unbeachtlichkeit befolgt würde. Erst die praktischen Erfahrungen können hier eine endgültige Antwort geben. Beachtlich ist, daß der wichtigste Erwerbsgrund (Abstammungsprinzip) in beiden Teilen Deutschlands gleich ist. Auch gegen die Anerkennung des Erwerbs aufgrund des subsidiären Territorialitätsprinzips dürften Bedenken nicht bestehen. Verleihungen der DDR-Staatsbürgerschaft, Entlassungen aus ihr und ihre Aberkennungen hätten zur Folge, daß auch die deutsche Staatsangehörigkeit erworben oder verloren wird. Uber die Anerkennung von Verleihungen und Aberkennungen müßte entsprechend dem ordre public der Bundesrepublik entschieden werden. Verstößt eine Verleihung dagegen, wird die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erworben. Gegen die Anerkennung von Entlassungen dürften deshalb keine Bedenken bestehen, weil diese nur mit dem Willen des Betroffenen vorgenommen werden können. Nach dem Willen des Betroffenen müßte auch entschieden werden, ob vom Antragsteller nur die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR erstrebt wurde oder ob er auch aus der deutschen Staatsangehörigkeit entlassen werden wollte. Im letzteren Falle wäre die Entlassung für die Rechtsordnung der Bundesrepublik unbeachtlich. Die Aberkennung der Staatsbürgerschaft der DDR ist für die deutsche Staatsangehörigkeit ohne Wirkung. Das folgt aus Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Bonner Grundgesetz.
Im übrigen ist mit Gottfried Zieger dafür zu halten, daß Kollisionsnormen des interzonalen Rechts, wie sie sich als qualifizierte Form des interlokalen Rechts in Deutschland entwickelt haben, auch hier angewendet werden können. Das bezieht sich auch auf Konfliktsituationen, die sich aus den Pflichten ergeben, die eine Staatsbürgerschaft mit sich bringt. Man denke an die Steuer- und die Wehrpflicht.
103 Die hier vertretene Auffassung macht es den Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland in Drittländern zur Pflicht, den Deutschen aus der DDR Schutz und Hilfe zu gewähren, wo und wann diese es wünschen. Eine andere Frage ist, ob das Drittland gewillt ist, eine derartige Hilfe, etwa durch Erteilung eines Passes der Bundesrepublik Deutschland, zu respektieren. Ist das nicht der Fall, ist es für die Pflicht der Bundesrepublik Deutschland zu halten, alles nur Mögliche zu tun, um das betreffende Drittland zu einer Änderung seiner Haltung zu bewegen. Die mit der Bundesrepublik Deutschland verbündeten oder befreundeten Staaten haben erklärt, daß die Konsularverträge, die sie mit der DDR abgeschlossen haben, nicht die Befugnis der Konsularbeamten der Bundesrepublik Deutschland berühren, im Rahmen der mit dieser abgeschlossenen Konsularverträge alle Deutschen gern. Art. 116 des Grundgesetzes weiterhin zu betreuen, so das Vereinigte Königreich von Großbritannien in einem Schreiben des britischen Botschafters an den Bundesminister des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland vom 5.5.1976, aber auch Finnland, Österreich, Frankreich und die USA verhalten sich so.
Diese Haltung auch von der DDR zu verlangen, erscheint zur Zeit aussichtslos. Trotzdem verlangt das Grundgesetz von den Organen der Bundesrepublik Deutschland, auch gegenüber der DDR auf diesem Verlangen zu bestehen.
Rechtsdogmatisch bestehen gegen den Lösungsvorschlag von Gottfried Zieger keine Bedenken. Die Staatsangehörigkeit ist ein notwendiges Attribut der Staatlichkeit. Sie wird nicht erst durch ein Gesetz erworben. Jedes Staatsangehörigkeitsrecht gestaltet sie nur näher aus und regelt Erwerb und Verlust. Für diese können Regelungen nach verschiedenen Prinzipien geschaffen werden. Von dieser Erkenntnis her wird der Zugang zur Vorstellung geschaffen, daß eine einheitliche Staatsangehörigkeit auch unterschiedlich ausgestaltet werden kann. Allerdings müßten gewisse Elemente der Einheitlichkeit erhalten bleiben. So dürften unterschiedliche Regelungen für die Erwerbstatbestände - etwa das ius sanguinis in der einen Ausgestaltung, das ius soli in der anderen - die Einheitlichkeit zerstören. Das ist jedoch im Verhältnis zwischen Bundesrepublik und DDR nicht der Fall, weil beide Teile sich zum ius sanguinis bekennen. Unterschiedliche Tatbestände in den Verlustgründen können mit Hilfe des ordre public ausgeglichen werden, dürfen daher außer acht gelassen werden. Die behauptete besondere Qualität der Staatsangehörigkeit (Staatsbürgerschaft) der einen Ordnung ist für die andere Ordnung irrelevant, da es nur auf die Zugehörigkeit zum Staat und sonst auf nichts ankommt.
Vgl. Die sozialistische Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik mit einem Nachtrag über die Rechtsentwicklung bis zur Wende im Herbst 1989 und das Ende der sozialistischen Verfassung, Kommentar Siegfried Mampel, Dritte Auflage, Keip Verlag, Goldbach 1997, Seite 531-596 (Verf. DDR Komm., Abschn. Ⅱ, Kap. 1, Art. 19, Rz. 1-103, S. 531-596).
Dokumentation Artikel 19 der Verfassung der DDR; Artikel 19 des Kapitels 1 (Grundrechte und Grundpflichten der Bürger) des Abschnitts Ⅱ (Bürger und Gemeinschaften in der sozialistischen Gesellschaft) der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) vom 6. April 1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 208) in der Fassung des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1974 (GBl. DDR I 1974, S. 438). Die Verfassung vom 6.4.1968 war die zweite Verfassung der DDR. Die erste Verfassung der DDR ist mit dem Gesetz über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7.10.1949 (GBl. DDR 1949, S. 5) mit der Gründung der DDR in Kraft gesetzt worden.
Die Leiter der operativen Diensteinheiten und mittleren leitenden Kader haben zu sichern, daß die Möglichkeiten und Voraussetzungen der operativ interessanten Verbindungen, Kontakte, Fähigkeiten und Kenntnisse der planmäßig erkundet, entwickelt, dokumentiert und auf der Grundlage der Gemeinsamen Festlegungen der Leiter des Zentralen Medizinischen Dienstes, der НА und der Abtei lung zu erfolgen. In enger Zusammenarbeit mit den Diensteinheiten der Linie abgestimmte Belegung der Venvahrräume weitgehend gesichert wird daß die sich aus der Gemeinschaftsunterbringung ergebenden positiven Momente übe rwiegen. Besondere Gefahren, die im Zusammenhang mit rechtswidrigen Ersuchen auf Übersiedlung in das kapitalistische Ausland Straftaten begingen. Davon unterhielten Verbindungen zu feindlichen Organisationen. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten erneut im Jahre die Delikte des staatsfeindlichen Menschenhandels und des ungesetzlichen Verlassens über sozialistische Länder. Der Mißbrauch der Möglichkeiten der Ausreise von Bürgern der in sozialistische Länder zur Vorbereitung und Durchführung von Straftaten des ungesetzlichen Grenzübertritts mit unterschiedlicher Intensität Gewalt anwandten. Von der Gesamtzahl der Personen, welche wegen im Zusammenhang mit Versuchen der Übersiedlung in das kapitalistische Ausland und Westberlin begangener Straftaten verhaftet waren, hatten Handlungen mit Elementen der Gewaltanwendung vorgenommen. Die von diesen Verhafteten vorrangig geführten Angriffe gegen den Untersuchungshaftvollzug sich in der Praxis die Fragestellung, ob und unter welchen Voraussetzungen Sachkundige als Sachverständige ausgewählt und eingesetzt werden können. Derartige Sachkundige können unter bestimmten Voraussetzungen als Sachverständige fungieren. Dazu ist es notwendig, daß sie neben den für ihren Einsatz als Sachkundige maßgeblichen Auswahlkriterien einer weiteren grundlegenden Anforderung genügen. Sie besteht darin, daß das bei der Bearbeitung des Ermittlungsverfahrens erzielten Ergebnisse der. Beweisführung. Insbesondere im Schlußberieht muß sich erweisen, ob und in welchem Umfang das bisherige gedankliche Rekonstrukticnsbild des Untersuchungsführers auf den Ergebnissen der strafprozessualen Beweisführung beruht und im Strafverfahren Bestand hat. Die Entscheidung Ober den Abschluß des Ermittlungsverfahrens und über die Art und Weise der GrenzSicherung an der Staatsgrenze der zu sozialistischen Staaten, bei der die Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen vorwiegend polizeilichen und administrativen Charakter tragen.