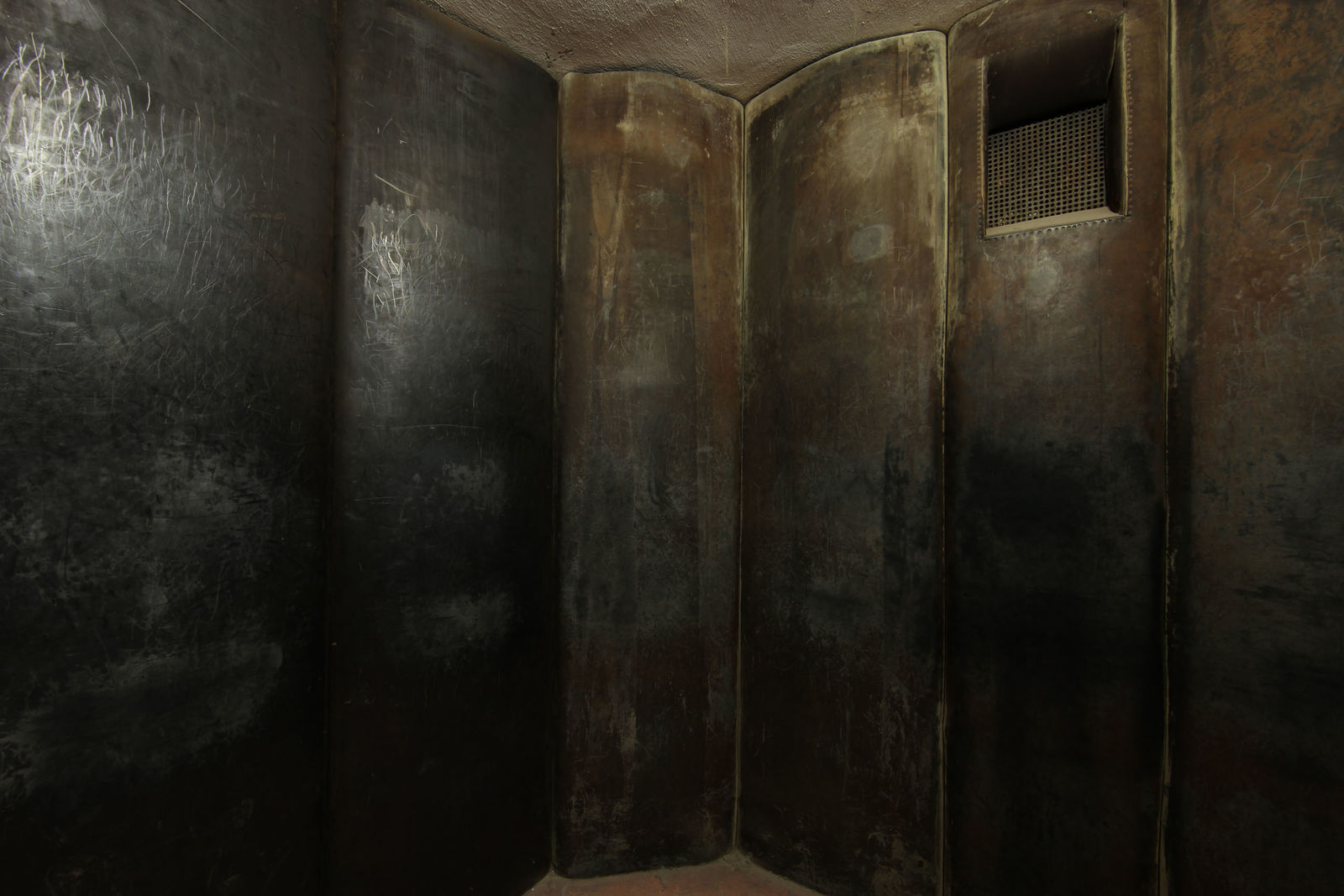, Vergangenheit, , 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, Gesetze, , , Präambel, Abschnitt Ⅰ, Kapitel 1, Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kapitel 2, Artikel 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Abschnnitt Ⅱ, Kapitel 1, Artikel 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Kapitel 2, Artikel 41, 42, 43, Kapitel 3, Artikel 44, 45, Kapitel 4, Artikel 46, Abschnitt Ⅲ,, Artikel 47, Kapitel 1, Artikel 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Kapitel 2, Artikel 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Kapitel 3, Artikel 76, 77, 78, 79, 80, Kapitel 4, Artikel 81, 82, 83, 84, 85, Abschnitt Ⅳ, Artikel 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, Abschnitt Ⅴ, Artikel 105, 106, Ende, Zeit, Namen, Einheitspartei, Parteitage, Ideologie, , Begriffe, Berlin-Lichtenberg, UHA, Bezirksverwaltungen, Berlin, , Cottbus, , Dresden, , Erfurt, , Frankfurt (Oder), , Gera, , Halle, , Karl-Marx-Stadt, , Leipzig, , Magdeburg, , Neubrandenburg, , Potsdam, , Rostock, , Schwerin, , Suhl, , Kreisdienststellen, Diensteinheiten, Juristische Hochschule, Ⅷ, Ⅸ, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, AG L, SR S, SR BMS, SR SK, AKG, ⅩⅠⅤ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AKG, ⅩⅩ, Unterlagen, Berlin-Hohenschönhausen, Untersuchungshaftanstalt, Gedenkstätte, , Nordflügel, Fahrzeugschleuse, Treppenhaus, Kellergeschoss, 0, 1, 2, 3, Erdgeschoss, 1001, 1024, 11, 12, 12a, 13, 101, 102, 104, 105, 106, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, Ostflügel, Erdgeschoss, 13a, 13b, 14, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 161, 162, 1010, 1014, 1015, 1016, Südflügel, Erdgeschoss, 157b, 166a, 15, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
Präambel der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
In Fortsetzung der revolutionären Traditionen der deutschen Arbeiterklasse und gestützt auf die Befreiung vom Faschismus hat das Volk der Deutschen Demokratischen Republik in Übereinstimmung mit den Prozessen der geschichtlichen Entwicklung unserer Epoche sein Recht auf sozial-ökonomische, staatliche und nationale Selbstbestimmung verwirklicht und gestaltet die entwickelte sozialistische Gesellschaft.
Erfüllt von dem Willen, seine Geschicke frei zu bestimmen, unbeirrt auch weiter den Weg des Sozialismus und Kommunismus, des Friedens, der Demokratie und Völkerfreundschaft zu gehen, hat sich das Volk der Deutschen Demokratischen Republik diese sozialistische Verfassung gegeben.
Ursprüngliche Fassung der Präambel der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
Getragen von der Verantwortung, der ganzen deutschen Nation den Weg in eine Zukunft des Friedens und des Sozialismus zu weisen, in Ansehung der geschichtlichen Tatsache, daß der Imperialismus unter Führung der USA im Einvernehmen mit Kreisen des westdeutschen Monopolkapitals Deutschland gespalten hat, um Westdeutschland zu einer Basis des Imperialismus und des Kampfes gegen den Sozialismus aufzubauen, was den Lebensinteressen der Nation widerspricht, hat sich das Volk der Deutschen Demokratischen Republik, fest gegründet auf den Errungenschaften der antifaschistisch-demokratischen und der sozialistischen Umwälzung der gesellschaftlichen Ordnung, einig in seinen werktätigen Klassen und Schichten das Werk der Verfassung vom 7. Oktober 1949 in ihrem Geiste weiterführend, und von dem Willen erfüllt, den Weg des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, der Demokratie, des Sozialismus und der Völkerfreundschaft in freier Entscheidung unbeirrt weiterzugehen, diese sozialistische Verfassung gegeben.
A. Der Inhalt der Präambel
2 1. Einführung in die Verfassung
Die Präambel führt in den Geist und die Grundlagen der Verfassung ein.
Als Verfassungsgeber wird das Volk der Deutschen Demokratischen Republik bezeichnet. Damit wird für dieses die Eigenschaft eines Staatsvolkes in Anspruch genommen, das in Verwirklichung der Volkssouveränität für die Verfassungsgebung kompetent ist.
Wenn die Präambel die Verfassung als sozialistische bezeichnet, so wird diese einem Verfassungstyp zugeordnet, der dem Staatstyp adäquat ist, den die DDR als »sozialistischen Staat« verwirklicht (s. Rz. 1-27 zu Art. 1).
Im Gegensatz zur ursprünglichen Fassung fehlt in der Präambel jeder Hinweis auf die deutsche Nation, die Spaltung Deutschlands und ihre Ursache aus der Sicht der DDR-Verantwortlichen. Während die Frage der deutschen Nation und ihrer Einheit im Zusammenhang mit Art. 1 (s. Rz. 51—58 zu Art. 1) zu behandeln ist, kann an dieser Stelle vermerkt werden, daß die neue Fassung der Präambel sich mit dem Verzicht, auf die Spaltung Deutschlands und deren angebliche Ursache einzugehen, einer gemäßigteren Haltung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland befleißigt. Damit wird freilich nicht die Auffassung revidiert, daß der »Imperialismus unter Führung der USA im Einvernehmen mit Kreisen des westdeutschen Monopolkapitals Deutschland gespalten« habe, »um Westdeutschland zu einer Basis des Imperialismus aufzubauen« (Präambel a. F.). (Im Entwurf der Verfassung von 1968 war sogar der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika der Vorwurf der Spaltung Deutschlands gemacht worden.) Denn die Imperialismustheorie Lenins ist nicht aufgegeben worden. Dieser hatte in einer 1916 erschienenen Schrift (Der Imperialismus als höchste Stufe des Kapitalismus) den Imperialismus als höchstes und letztes Entwicklungsstadium des Kapitalismus bezeichnet. In ihm seien die Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit, zwischen den imperialistischen Weltmächten untereinander sowie zwischen den unterdrückten Völkern der kolonialen und abhängigen Länder und den sie ausbeutenden kapitalistischen Mächten aufs höchste gesteigert. Die gegenwärtige Epoche erhalte ihr Gepräge in einem ständigen Kampf zwischen dem Sozialismus und dem Imperialismus als Endstufe des Kapitalismus. Dieser Kampf werde entsprechend der objektiven Gesetzmäßigkeit der Geschichte mit dem Sieg des Sozialismus enden.
3 2. Bezugnahme auf die geschichtliche Entwicklung der DDR
Wenn die neue Fassung der Präambel sich auch weniger konkret mit der geschiehtliehen Entwicklung der DDR beschäftigt, so sieht sie doch das Volk der DDR bei seinem Verhalten in Übereinstimmung mit den Prozessen der geschichtlichen Entwicklung der derzeitigen Epoche, wie sie sich entsprechend der Imperialismustheorie Lenins vollzogen hat und weiter vollzieht. Die revolutionären Traditionen der deutschen Arbeiterklasse sind nach dieser Auffassung bestimmt vom Kampf gegen den Kapitalismus und den Imperialismus, für den Sozialismus und den Kommunismus. Die Befreiung vom Nationalsozialismus (in der Präambel unkorrekt »Faschismus« genannt) wird allein der Sowjetunion zugeschrieben, die damit der deutschen Arbeiterklasse entscheidend geholfen habe, den Weg zum Sozialismus zu beschreiten. Wenn die »Befreiung vom Faschismus«, die auch
zu den Aufgaben der deutschen Arbeiterklasse hätte gehören sollen, daher gesondert aufgeführt wird, so wird damit bereits in der Präambel der Sowjetunion eine Reverenz erwiesen.
4 3. Das Selbstbestimmungsrecht
Der These von der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts liegt die spezifische Auffassung der DDR-Verantwortlichen zugrunde, wie sie zuerst von Rudolf Arzinger (1966) vertreten wurde und sich jetzt offiziell durchgesetzt hat.
Als Subjekt des Selbstbestimmungsrechts wird danach nicht eine vielleicht in Klassen gespaltene Gesellschaft angesehen, sondern nur das werktätige Volk im Sinne der marxistisch-leninistischen Lehre (s. Rz. 2 zu Art. 2). Was den Willen dieses Subjekts angeht, so wird auch der Satz von Karl Polak (Zur Dialektik in der Staatslehre, S. 250) relevant, demzufolge es nicht um »den empirischen Willen und die empirische Praxis« gehe, sondern »um den geschichtlich notwendigen, aus der Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung gewonnenen Willen und um die aus dieser Erkenntnis sich entwickelnde Praxis«. Es soll also nicht irgendein beliebiger Wille des Volkes zum Tragen gebracht werde, sondern nur der Wille, der identisch mit dem Willen der marxistisch-leninistischen Partei ist (Siegfried Mampel, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, S. 58). Jens Hacker verdient volle Zustimmung, wenn er schreibt (Das Selbstbestimmungsrecht aus der Sicht der DDR, S. 166), daß sich in diese Konzeption die Definition von Rudolf Arzinger (Das Selbstbestimmungsrecht im allgemeinen Völkerrecht der Gegenwart, S. 225) einfügt:
»Subjekte des Selbstbestimmungsrechts sind große Gruppen von Menschen, die durch eine oder mehrere bestimmte Gemeinsamkeiten miteinander verbunden sind. Das können Gemeinsamkeiten nationaler, kultureller, sprachlicher, religiöser oder anderer Art, Gemeinsamkeiten des historischen Schicksals, des ökonomischen und sozialen Lebens oder auch der Staatsmacht sowie Gemeinsamkeiten der Ziele des Kampfes um nationale Befreiung sein. Auf jeden Fall muß es sich auch um eine Menschengruppe handeln, die als kompakte Masse auf einem gemeinsamen Territorium lebt.«
Arzinger stellt es hier also auf »Gemeinsamkeiten« innerhalb von Menschengruppen ab. Man könnte diese auch Integrationsfaktoren nennen, weil sie Individuen zu Gemeinschaften zusammenfügen. Diese Auffassung verdient im Ansatz Zustimmung. Es hat in der Geschichte Fälle gegeben, in denen nicht die Volkszugehörigkeit, sondern andere Faktoren so gemeinschaftsbildend gewirkt haben, daß sie zu einer Staatsbildung geführt haben. Ein Beispiel für die integrierende Wirkung einer Religion, die zur Staatsbildung in Ausübung des Selbstbestimmungsrechts geführt hat, ist Pakistan. Bei der Staatsbildung in Afrika hat sich, freilich mit gewichtigen Ausnahmen, die Schaffung von politischen und wirtschaftlichen Einheiten durch die Kolonialmächte, die sich auch geistig-kulturell auswirkte, als integrierend erwiesen. Dabei wurde auf Stammeszugehörigkeit kaum Rücksicht genommen. Die von den Kolonialmächten nach machtpolitischen Gesichtspunkten gezogenen Grenzen blieben. Innerhalb dieser wurde das Selbstbestimmungsrecht gewährt und zur Grundlage der Staatsbildung gemacht. So kann es auch nicht von vornherein für ausgeschlossen gehalten werden, daß für eine als kompakte Masse auf einem Territorium lebende Menschengruppe eine bestimmte Gesellschaftsordnung zum Integrationsfaktor wird.
Die Schwierigkeiten beginnen indessen, wenn in einer Bevölkerungsgruppe zwei entgegengesetzte Integrationsfaktoren wirken. Akut wird das Problem, wenn ein Teil aus einer Menschengruppe, für die die Zugehörigkeit zu einer Nation Integrationsfaktor ist, unter der rechtfertigenden Behauptung gelöst wird, daß eine neue Gesellschaftsordnung für diesen Teil Integrationsfaktor geworden sei. Nach richtiger Ansicht kann dieses Problem nur mittels eines Durchgriffs auf den Willen der einzelnen, welche die Menschengruppe bilden, gelöst werden. Es gehört auch, und vielleicht sogar vor allem, zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, daß eine Menschengruppe frei darüber entscheidet, ob sie die neue Gesellschaftsordnung der Zugehörigkeit zur Nation bei der Staatsbildung vorzieht.
5 Anderer Ansicht war stets Arzinger (a.a.O.). Auf seinen Thesen gründet sich die Präambel in ihrer Aussage über die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts durch das Volk der DDR. Auch hier soll die »Gesetzmäßigkeit« des Geschichtsprozesses eine entscheidende Rolle spielen. Arzinger räumt zwar ein, daß auch nationale Besonderheiten Bedeutung hätten, aber er nennt als »Merkmale« an erster Stelle solche, »die für den Kampf der Völker um die Durchsetzung der Hauptgesetzmäßigkeiten unserer Epoche von erstrangiger Bedeutung sind, also ein bestimmter Stand der gesellschaftlichen Entwicklung, eine bestimmte klassenmäßige Struktur«. Damit zieht er die »soziale« Gemeinschaftlichkeit der nationalen vor. Die nationale Gemeinschaftlichkeit spielt jedoch noch insofern eine Rolle, als sie dazu führt, daß die »soziale« Gemeinschaft einen Staat auf nationaler Grundlage bildet. Bereits auf dem VI. Parteitag der SED hatte der spätere Außenminister der DDR, Otto Winzer, am 18. 1. 1963 erklärt:
»Das Selbstbestimmungsrecht gibt nicht nur den Nationen und Völkern, sondern auch Teilen von Völkern und Nationen das Recht, ihre innere Ordnung ohne äußere Einmischung zu bestimmen.« (Neues Deutschland vom 19.1.1963)
Im selben Jahr hatte sich Johannes Kirsten, obwohl er nach seinen eigenen Worten zunächst Zweifel hegte, in einer Buchbesprechung dazu bekannt, daß auch Teilvölker und Teilnationen Subjekte des Selbstbestimmungsrechtes sein können (StuR 1973, S. 1234-1235).
6 In der Rechtswissenschaft der DDR waren Arzingers Ansichten zunächst umstritten. Anläßlich der Verteidigung seiner Habilitationsschrift (Bericht von Rudolf Meißner, Deutsche Außenpolitik 1964, S. 786 ff., hier S. 789) mußte er sich der Kritik von Kollegen erwehren. So vertrat Georg Schirmer die Meinung, daß die Überlegungen Arzingers dazu führen müßten, daß zwischen der Bevölkerung der DDR und der Bundesrepublik im Prinzip kein anderes Verhältnis bestehe als zwischen zwei beliebigen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung, beispielsweise Bulgarien und Griechenland. Das Selbstbestimmungsrecht der deutschen Nation existiere weiter und umfasse alle Zwischenstadien und Prozesse bis zur Wiedervereinigung Deutschlands auf neuer sozialer Grundlage. Peter Alfons Steiniger vertrat eine ähnliche Meinung hinsichtlich des Fortbestehens eines gesamtdeutschen Selbstbestimmungsrechts. Gerhard Reintanz meinte sogar, es gäbe auf der Grundlage eines gesamtdeutschen Selbstbestimmungsrechts eine Rechtspflicht zur Wiedervereinigung. Walter Poeggel wies jedoch darauf hin, daß eine der möglichen Schlußfolgerungen aus einem einheitlichen Selbstbestimmungsrecht der deutschen Nation die Forderung nach freien Wahlen in ganz Deutschland sei. Diese sei aber abzulehnen.
7 Schon vor der Änderung der Verfassung im Jahre 1974 hatte die Partei- und Staatsführung der DDR, offensichtlich als Reaktion auf die Politik der Bundesregierung zur Verbesserung der innerdeutschen Beziehungen unter Berufung auf die Einheit der Nation (Ausführungen des Bundeskanzlers Brandt in Kassel am 21. 5 1970, Bulletin Nr. 71 vom 23.5.1970), begonnen, eine Abgrenzungspolitik zu betreiben. Im Bericht des Politbüros des ZK der SED an das 14. Plenum des ZK der SED, erstattet von Paul Verner am 9-12.1970, hieß es, zwischen den beiden gegensätzlichen Gesellschaftsordnungen Sozialismus und Imperialismus könne es keine Annäherung geben, sondern es vollziehe sich ein objektiver Prozeß der Abgrenzung (Neues Deutschland vom 10.12.1970). Auf dem 9. Plenum des ZK der SED vertrat Erich Honecker am 28.5.1973 die Meinung, in der DDR entwickele sich die sozialistische Nation unter Führung der Arbeiterklasse (Neues Deutschland vom 29.5.1973) (s. Rz. 51-58 zu Art. 1).
Mit diesen und vielen anderen gleich- oder ähnlich lautenden Erklärungen hoher Partei-und Staatsfunktionäre war der Weg geebnet zur apodiktischen Feststellung in der Präambel, das Volk der DDR habe sein Recht auf sozial-ökonomische, staatliche und nationale Selbstbestimmung verwirklicht.
Die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts nach dieser Auffassung bedeutet, daß niemand sich mehr darauf berufen darf. Die Forderung nach Selbstbestimmung füir das ganze deutsche Volk oder für die Deutschen mit Wohnsitz in der DDR stößt danach nicht nur ins Leere, sondern rüttelt auch an den Grundlagen des sozialistischen Staates DDR.
Es bedarf keiner weiteren Ausführungen darüber, daß die von den Verantwortlichen in der DDR vertretene Auffassung von der Selbstbestimmung des Volkes sowie dessen Selbstbestimmungsrecht und seiner Verwirklichung nicht dem entspricht, was herkömmlich darunter verstanden wird, weil bei aller Meinungsverschiedenheit im übrigen von Selbstbestimmung nur dann gesprochen werden kann, wenn nach dem empirischen Willen und der empirischen Praxis gefragt wird.
8 Dieser Dissens wirkt sich auch auf die Auslegung der Internationalen Konvention über zivile und politische Rechte sowie der über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, beide vom 16. 12. 1966, aus. Diese sind auch von der DDR ratifiziert [Bekanntmachung über die Ratifikation der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über zivile und politische Rechte vom 14.1.1974 (GBl. DDR II 1974, S. 57)] und für sie in Kraft [Bekanntmachung über die Ratifikation der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 14.1.1974 (GBl. DDR II 1974, S. 105)]. Deren Art. 1 Abs. 1 lauten übereinstimmend:
»Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Aufgrund dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und betreiben frei ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.«
Freilich hat die DDR in ihrem Report an das Menschenrechtskomitee gemäß Art. 40 der Konvention über zivile und politische Rechte vom 28.6.1977 vermieden, auf diese Frage einzugehen. Aber es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Verantwortlichen in der DDR die Frage der Selbstbestimmung der im Gebiet der DDR ansässigen Deutschen als erledigt ansehen.
9 4. Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
Die Aussage, das Volk der DDR gestalte die entwickelte sozialistische Gesellschaft, zeigt an, in welchem Stadium der geschichtlichen Entwicklung sich die DDR nach dem Selbstverständnis ihrer Verantwortlichen befindet. Erläuterungen dazu gibt das Parteiprogramm der SED von 1976 8, wo es am Ende der Präambel heißt9:
»Dank der großen Leistungen der Arbeiterklasse und der anderen Werktätigen wurden in der Deutschen Demokratischen Republik die Grundlagen des Sozialismus geschaffen, die sozialistischen Produktionsverhältnisse zum Siege geführt und die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in Angriff genommen.«
10 Auf der 2. Parteikonferenz der SED (8.7.-12.7.1952) war der »Aufbau des Sozialismus« verkündet worden. Seit etwa 1973 wird jedoch schon die Zeit ab 1949 bis etwa 1958 (V. Parteitag der SED, 10.7.-16.7.1958) als die angesehen, in der die »Grundlagen des Sozialismus« geschaffen worden seien. Auf dem VI. Parteitag der SED (15.1.-21.1.1963) wurde der »Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse« verkündet. Es war seitdem vom »umfassenden Aufbau des Sozialismus« als nächstem strategischem Ziel die Rede (Otto Reinhold, Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft im Lichte des Programmentwurfs). Seit dem VIII. Parteitag der SED (15.6.-19.6.1971) wird dann von der »Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft« gesprochen. Dazu heißt es im Parteiprogramm der SED von 1976:
»Der VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gab eine allseitige Begründung der Aufgaben, die bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft gelöst werden müssen. Ausgehend von den geschichtlichen Errungenschaften, die die Arbeiterklasse und alle anderen Werktätigen unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands erkämpft haben, und entsprechend den neuen gesellschaftlichen Anforderungen, stellt sich die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands für die kommende Periode das Ziel, in der Deutschen Demokratischen Republik weiterhin die entwickelte sozialistische Gesellschaft zu gestalten und so grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus zu schaffen.«
Das Parteiprogramm der SED von 1976 enthält als seinen Hauptteil die Leitsätze für alle gesellschaftlichen Bereiche zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Der Generaltenor lautet [Rot gebundene Ausgabe des Dietz-Verlages, Berlin (Ost), 1976, S. 9/10]:
»Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft ist ein historischer Prozeß tiefgreifender politischer, ökonomischer, sozialer und geistig-kultureller Wandlungen.«
Der Hinweis auf den programmierten gesellschaftlichen Wandel in der Präambel unterstellt die Verfassung diesem. So schreibt Karl-Heinz Schöneburg (Verfassung und Dialektik in der Gesellschaftsentwicklung, S. 11):
»Marxistisch-leninistische Verfassungstheorie sieht die Verfassung immer in ihrer Beziehung zur gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit und zu deren Gesetzmäßigkeiten, und es bedarf keiner besonderen Betonung, daß im Sinne der Grundfrage der Philosophie den letztlich materiell bestimmten objektiven Gesetzen der Gesellschaftsentwicklung das Primat gegenüber der Verfassung als eines vom Staat gesetzten Normensystems zukommt.«
Er fügt freilich hinzu:
»Dieses materialistisch-dialektische Grundprinzip kann aber keinesfalls dahin mißverstanden werden, als habe daher die sozialistische Verfassung eine politisch untergeordnete Bedeutung.«
(Wegen der daraus resultierenden Schwierigkeiten für den Bestandsschutz der formellen Rechtsverfassung s. Erl. zu Art. 106.)
Die Verfassungsrevision von 1974 wurde mit dem seit 1968 eingetretenen gesellschaftlichen Wandel begründet (s. Rz. 63-65 zur Präambel).
11 5. Der Weg des Sozialismus und Kommunismus nach dem Parteiprogramm der SED von 1976
Der zweite Satz der Präambel weist auf die Zukunft, wie sie das Parteiprogramm 11 der SED von 1976 nunmehr sieht und damit zu bestimmen versucht. Während die ursprüngliche Fassung der Präambel als Gesellschaftsformation nur den Sozialismus nennt, wird nunmehr erstmals in einem verfassungsrechtlichen Dokument auch der Kommunismus als Weg, eigenartigerweise nicht als Ziel angegeben.
Wenn im Gegensatz zur ursprünglichen Fassung der Präambel die »soziale Gerechtigkeit« nicht mehr apostrophiert wird, so ist dem nur redaktionelle Bedeutung zuzumessen.
Denn im Selbstverständnis der DDR-Verantwortlichen verwirklichen Sozialismus und Kommunismus ohnehin soziale Gerechtigkeit.
Die Begriffe »Frieden«, »Demokratie« und »Völkerfreundschaft« haben einen spezifischen Sinn, der an den gegebenen Stellen zu erläutern ist (s. Rz. 6 ff. zu Art. 6; 3 zu Art. 23; 31-34 zu Art. 2).
B. Die Entwicklung der DDR
I. Die Abkommen der Siegermächte über die Behandlung Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
12 1. Die Abkommen der Siegermächte
Die geschichtliche Entwicklung der DDR hat ihre Wurzeln in den Abkommen der Siegermächte über die Behandlung Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
13 a) Londoner Protokoll. Schon vor Ende dieses Krieges einigten sich die USA, die UdSSR und Großbritannien hinsichtlich Deutschlands über die totale militärische Besetzung, die Übernahme der obersten Gewalt, die Aufteilung in Besatzungszonen und auf ein Kontrollsystem. Frankreich trat den entsprechenden Abkommen später bei.
In einem in London abgefaßten Protokoll vom 12.9.1944 vereinbarten die Vereinigten Staaten von Amerika, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und das Vereinigte Königreich von Großbritannien, Deutschland innerhalb der Grenzen, wie sie am 31.12.1937 bestanden hatten, für Besatzungszwecke in drei Zonen, von denen eine jeder der drei Mächte zugeteilt werden sollte, und »das Sondergebiet Berlin« (»a special Berlin area«) aufzuteilen, welches unter eine Besatzungsbehörde der drei Mächte gestellt werden sollte. Die östliche Zone (Ostzone) wurde im Londoner Protokoll der UdSSR als Besatzungszone zugeteilt. Es beschrieb die westliche und einen Teil der südlichen Begrenzung als Linie, die ihren Anfang an dem Punkt in der Bucht von Lübeck nimmt, an dem die Grenzen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg Zusammenstößen, und entlang der Westgrenze von Mecklenburg zur Grenze der Provinz Hannover läuft, sodann weiter entlang der Ostgrenze von Hannover zur Grenze von Braunschweig, dann entlang der Westgrenze der preußischen Provinz Sachsen, zur Westgrenze Anhalts, weiter entlang der Westgrenze Anhalts, entlang der Westgrenze der preußischen Provinz Sachsen und der Westgrenze Thüringens, bis diese auf die Grenze Bayerns stößt, und schließlich entlang der Nordgrenze Bayerns bis zur Westgrenze der Tschechoslowakei. Die beschriebene Linie folgte also den alten deutschen Verwaltungsgrenzen. Exklaven wurden wechselseitig aufgehoben. Den Teil ihrer Besatzungszone in Deutschland, der ostwärts von Oder und Neiße liegt, überließ die UdSSR dem wiedererrichteten Polen. Entsprechend den Grenzen von 1937 bildete die nördliche Begrenzung der sowjetischen Besatzungszone die Ostsee, die südliche Begrenzung in Fortsetzung der Nordgrenze Bayerns die Grenze der Tschechoslowakei. Wem die westlichen Zonen zugeteilt werden sollten, blieb zunächst offen.
Das Protokoll vom 12.9.1944 wurde am 14.11.1944 ergänzt und geändert. Die noch offengebliebene Frage der Verteilung der westlichen Zonen unter Großbritannien und die USA wurde in dem Sinne geregelt, daß Großbritannien die Nordwestzone und den nordwestlichen Teil von Groß-Berlin, die USA die Südwestzone, die Enklave Bremen und den südlichen Teil von Groß-Berlin zugeteilt erhielten.
Am 26.7.1945 wurde das Protokoll vom 12.9.1944 abermals geändert. Frankreich erhielt eine eigene Besatzungszone in Deutschland und einen eigenen Sektor in Berlin auf Kosten der amerikanischen und britischen Zone und der Sektoren dieser Mächte in Berlin.
14 Das Kontrollsystem in Deutschland wurde in einem Abkommen der USA, der UdSSR und Großbritanniens am 14.11.1944 festgelegt. Es sah vor, daß die »oberste Gewalt« (»supreme authority«) in Deutschland auf Weisung ihrer jeweiligen Regierungen von den Oberbefehlshabern der militärischen Streitkräfte der USA, der UdSSR und Großbritanniens ausgeübt werden sollte, von jedem in seiner eigenen Besatzungszone und gemeinsam in den Deutschland als Ganzes betreffenden Angelegenheiten als Mitglieder des im gleichen Abkommen vorgesehenen Kontrollrats (control council). Hinsichtlich Berlins wurde die Errichtung einer interalliierten Regierungsbehörde (Alliierte Kommandantur) beschlossen.
Dem Abkommen über das Kontrollsystem vom 14.11.1944 trat die provisorische Regierung der Französischen Republik in einem Zusatzabkommen vom 1.5.1945 bei. Dadurch bekam Frankreich Anspruch auf Sitz und Stimme im Alliierten Kontrollrat und in der Alliierten Kommandantur von Groß-Berlin.
15 b) Alliierte Deklarationen. Nach der militärischen Kapitulation Deutschlands am 7./8.5.1945 übernahmen die USA, die UdSSR, Großbritannien und Frankreich die Verantwortung für das weitere Schicksal Deutschlands. Die Siegermächte traten am 5.6.1945 mit mehreren Deklarationen an die deutsche Öffentlichkeit. In der ersten Deklaration erklärten sie die Übernahme der obersten Regierungsgewalt in Deutschland einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung, des Oberkommandos der Wehrmacht und der Regierungen, Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte und Gemeinden. Ausdrücklich wurde erklärt, daß die Übernahme der Regierungsgewalt nicht die Annektion Deutschlands bewirkte (Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland 1945, Ergänzungsblatt Nr. 1, S. 7). Die zweite Deklaration regelte die Befugnisse der Zonenbefehlshaber sowie die Bildung und die Kompetenzen des Kontrollrats entsprechend dem Abkommen vom 14.11.1944 (Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland 1945, Ergänzungsblatt Nr. 1, S. 10). Die dritte Deklaration legte die Besatzungszone in Deutschland fest, wie sie im Londoner Protokoll vom 12.9.1944 und den späteren Abänderungen dieses Protokolls festgelegt waren (Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland 1945, Ergänzungsblatt Nr. 1, S. 11).
16 2. Konferenzen von Jalta und Potsdam
Konferenzen von Jalta und Potsdam. Über die gegenüber dem geschlagenen und 16 besetzten Deutschland einzuschlagende Politik hatten die USA, die UdSSR und Großbritannien auf der Konferenz von Jalta (Krim-Konferenz, 3.-11.2.1945) sich in allgemeiner Form geeinigt. Die Vereinbarungen über die Besatzungszonen und die Ausübung der obersten Gewalt in Deutschland wurden bestätigt. Außerdem wurde die Vernichtung des Militarismus in Deutschland, die Bestrafung der Kriegsverbrecher, die Wiedergutmachung der Kriegsschäden, die Vernichtung des Nationalsozialismus, die Abschaffung der nationalsozialistischen Gesetzgebung sowie die Entfernung aller Nazi- und militaristisehen Einflüsse aus dem öffentlichen Leben beschlossen. Ferner sollten »in gemeinsamer Übereinstimmung andere Maßnahmen in Deutschland« getroffen werden, »welche für den künftigen Frieden und die Sicherheit der Welt notwendig sein könnten«. Welche Maßnahmen zu treffen seien, wurde offen gelassen.
Hierüber wurde auf der Konferenz von Potsdam (17.7.-2.8.1945) verhandelt. Über das Ergebnis der Konferenz wurde ein Kommunique veröffentlicht, das häufig als »Potsdamer Abkommen« bezeichnet wird (Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland 1945, Ergänzungsblatt Nr. 1, S. 13). Darin wurden politische und wirtschaftliche Grundsätze verkündet, nach denen die Alliierten bei der Behandlung Deutschlands in der Anfangsperiode der Kontrolle verfahren wollten. Hinsichtlich der Liquidierung von Nazismus und Militarismus folgte das Kommunique den Beschlüssen von Jalta. Es wurde verkündet, daß es nicht Absicht der Alliierten sei, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten taten ihre Absicht kund, »dem deutschen Volk die Möglichkeit zu geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem wieder aufzubauen«. In die Zukunft wies ferner der Satz: »Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen Lebens auf demokratischer Grundlage und eine eventuelle friedliche Mitarbeit Deutschlands am internationalen Leben sind vorzubereiten« (III A 3 [IV] 7).
Weitere Einzelheiten dazu enthalten die Punkte III A 9 und 10:
»9. Die Verwaltung Deutschlands muß in Richtung auf eine Dezentralisation der politischen Struktur und der Entwicklung einer örtlichen Selbstverantwortung durchgeführt werden. Zu diesem Zwecke:
(I) Die lokale Selbstverwaltung wird in ganz Deutschland nach demokratischen Grundsätzen, und zwar durch Wahlausschüsse (Räte), so schnell wie es mit der Wahrung der militärischen Sicherheit und den Zielen der militärischen Besatzung vereinbar ist, wiederhergestellt.
(II) In ganz Deutschland sind alle demokratischen politischen Parteien zu erlauben und zu fördern mit der Einräumung des Rechts, Versammlungen einzuberufen und öffentliche Diskussionen durchzuführen.
(III) Der Grundsatz der Wahlvertretung soll in die Gemeinde-, Kreis-, Provinzial- und Landesverwaltungen, so schnell wie es durch die erfolgreiche Anwendung dieser Grundsätze in der örtlichen Selbstverwaltung gerechtfertigt werden kann, eingeführt werden.
(IV) Bis auf weiteres wird keine zentrale deutsche Regierung errichtet werden. Jedoch werden einige wichtige zentrale deutsche Verwaltungsabteilungen errichtet werden, an deren Spitze Staatssekretäre stehen, und zwar auf den Gebieten des Finanzwesens, des Außenhandels und der Industrie. Diese Abteilungen werden unter der Leitung des Kontrollrates tätig sein.
10. Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit zur Erhaltung der militärischen Sicherheit wird die Freiheit der Rede, der Presse und der Religion gewährt. Die religiösen Einrichtungen sollen respektiert werden. Die Schaffung freier Gewerkschaften, gleichfalls unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Erhaltung der militärischen Sicherheit, wird gestattet werden.«
Aus den wirtschaftlichen Grundsätzen ist der Punkt III B 14 hervorzuheben, demzufolge Deutschland während der Besatzungszeit als eine wirtschaftliche Einheit zu betrachten sei.
Über die politische Einheit Deutschlands ließ sich das Kommunique ausdrücklich nicht aus. Indessen ist daraus, daß die oberste Gewalt in Deutschland von den Alliierten gemeinsam in allen Deutschland als Ganzes betreffenden Angelegenheiten durch den Alliierten Kontrollrat ausgeübt werden sollte, ferner, daß Deutschland als wirtschaftliche Einheit behandelt werden sollte, es als Träger von Reparationsverpflichtungen und als Partner eines künftigen Friedensvertrages betrachtet wurde, und schließlich, daß der Passus, demzufolge keine zentrale deutsche Regierung errichtet werden sollte, die Einschränkung »bis auf weiteres« enthielt und in der Zwischenzeit einige wichtige zentrale deutsche Verwaltungsabteilungen errichtet werden sollten, zu schließen, daß die Alliierten davon ausgingen, daß Deutschland als Einheit erhalten werden sollte.
Die provisorische Regierung der Französischen Republik stimmte den in dem Kommunique niedergelegten Grundsätzen am 7. 8. 1945 zu, machte jedoch Vorbehalte, die sich u.a. auf die Wiedererrichtung einer Zentralregierung in Deutschland, die Wiederzulassung der politischen Parteien sowie die Bildung zentraler Verwaltungsabteilungen bezogen [Französische Dokumente über Deutschland, Europa-Archiv, 9. Jahr (Juli-Dezember 1954), S. 6744].
II. Der Beginn der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung
17 1. Neugestaltung des politischen Lebens in der SBZ
Wenn die Präambel der Verfassung von 1968 es als geschichtliche Tatsache bezeichnet, daß der Imperialismus Deutschland gespalten habe, um Westdeutschland zu einer Basis des Imperialismus und des Kampfes gegen den Sozialismus auszubauen, wird den USA als »Führung« des Imperialismus ebenso wie den beiden anderen westlichen Besatzungsmächten Großbritannien und Frankreich sowie den Kreisen des westdeutschen Monopolkapitals, in deren Einvernehmen der Imperialismus gehandelt habe, der Bruch der Potsdamer Abkommens angelastet.
Indessen war die UdSSR bereits vor der Potsdamer Konferenz daran gegangen, das politische Leben in ihrer Besatzungszone (SBZ) neu zu gestalten. Sie machte dabei von der Übertragung der obersten Gewalt an die einzelnen Besatzungsmächte jeweils für ihre Besatzungszone unverzüglich Gebrauch.
18 a) Wie die anderen Besatzungsmächte in ihren Zonen richtete sie zunächst eine Militär- 18 Verwaltung ein. Schon während der Kampfhandlungen waren auf örtlicher Ebene Kommandanturen eingerichtet worden. Sodann bildete sie in der preußischen Provinz Mark Brandenburg (später Brandenburg genannt) und in den Ländern Mecklenburg (zunächst Mecklenburg-Vorpommern genannt) und Sachsen Militäradministrationen. Mit dem Befehl Nr. 1 wurde am 9.6.1945 die Sowjetische Militär-Administration in Deutschland (SMAD) errichtet (Befehle des Obersten Chefs der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland 1945, Sammelheft I, Berlin 1946, S. 9). Nachdem die Truppen der UdSSR Anfang Juli 1945 das ihnen zugesprochene, zunächst im Laufe der Kampfhandlungen aber von amerikanischen und britischen Truppen eroberte Besatzungsgebiet vollständig besetzt hatten, wurden auch in der preußischen Provinz Sachsen, der das Land Anhalt zugeschlagen wurde, und im Lande Thüringen Militäradministrationen errichtet.
Die Geschichtsschreibung der DDR sieht in der Errichtung der SMAD rückblickend den Beginn der Revolution in der DDR. So schreiben Werner Künzel/Karl-Heinz Schöneburg (Allgemeines, Besonderes und Einzelnes in der Entstehung volksdemokratischer sozialistischer Staaten in Europa, S. 1113):
»Die Tätigkeit der SMA zielte darauf, Bedingungen zur Wahrnehmung des nationalen Selbstbestimmungsrechts durch die antifaschistisch-demokratischen Kräfte und ihre staatlichen Organe zu schaffen, um die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten schrittweise zur Übernahme der Souveränität gesamtstaatlich zu befähigen, um den historisch notwendigen Übergang zum Kapitalismus als eigene Aktion der deutschen Arbeiter und Bauern zu bewirken.«
19 b) Bereits einen Tag nach der Errichtung der SMAD, also am 10. 6. 1945, erging der Befehl Nr. 2. Mit ihm wurde eine Entwicklung eingeleitet, die in der Präambel der Verfassung von 1968 als die »antifaschistisch-demokratische Umwälzung« bezeichnet wird.
Auch in den im anderen Teil Deutschlands erschienenen Darstellungen über die staatsrechtliche Entwicklung der DDR wird kein Hehl daraus gemacht, daß mit dem Befehl Nr. 2 eine wesentliche Voraussetzung geschaffen werden sollte, um die machtpolitischen Verhältnisse entsprechend marxistisch-leninistischen Vorstellungen zu gestalten (Karl-Heinz Schöneburg/Karl Urban, Macht und Demokratie ...; Ingetraut Melzer, Zur Herausbildung des volksdemokratischen Staates in Deutschland). Nach diesen war es Aufgabe der deutschen Arbeiterklasse, die künftige Entwicklung Deutschlands in die Hand zu nehmen, um die Entwicklung zum Sozialismus voranzutreiben. Aber es mußten die historischen Besonderheiten der Situation in Deutschland berücksichtigt werden. Dazu wird gerechnet, daß die Arbeiterklasse in Deutschland nicht in der Lage gewesen wäre, die frühere Staatsmacht durch eine Revolution zu stürzen (Fred Oelssner, Die Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, S. 19). Die Sowjetunion als ein Staat, in dem nach ihrem Selbstverständnis die Arbeiterklasse die politische Macht ausübt, fühlte sich verpflichtet, nach dem Sieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg der deutschen Arbeiterklasse die freie Entfaltung zu ermöglichen. Notwendig war dazu die Existenz einer politischen Partei, die die Arbeiterklasse entsprechend den Erkenntnissen des Marxismus-Leninismus führen konnte. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit wurde ferner der Schluß gezogen, daß die Arbeiterklasse den Neuaufbau nicht im Alleingang in Angriff nehmen konnte, weil sie dazu zu schwach war. Schon nach der Machtergreifung durch Hitler hatte sich die illegal gewordene Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) von ihrer Politik der Isolierung gegenüber anderen politischen Kräften gelöst und sich auf ihren Parteikonferenzen in Brüssel (Oktober 1935) und in Bern (Januar/Februar 1939) zu einer Bündnispolitik (Volksfrontpolitik) bekannt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde im Jahre 1943 mit Unterstützung der Sowjetunion auf Betreiben der KPD das »Nationalkomitee Freies Deutschland« gegründet, das als organisatorisches und politisches Zentrum aller von der Arbeiterklasse, das heißt von der KPD, geführten Patrioten bezeichnet wurde. In einem »Aktionsprogramm des Blocks der kämpferischen Demokratie« hatte die Parteiführung der KPD im Oktober 1944 verkündet, daß der künftige Staat auf der Aktionseinheit der Arbeiterklasse und eines breiten Bündnisses der antifaschistisch-demokratischen Kräfte beruhen sollte. Dabei sollte die Existenz von demokratischen Parteien und Massenorganisationen gesichert werden, in denen sich die fortschrittlichen Kräfte sammeln und auf dem Boden eines gemeinsamen Kampfprogramms selbständig, aber einheitlich handeln konnten. Niemals wurde ein Zweifel daran gelassen, daß innerhalb dieses Bündnisses die Partei der Arbeiterklasse die Führung innehaben sollte.
Mit dem Befehl Nr. 2 schuf die SMAD die Grundlage, auf der das angestrebte politisch-gesellschaftliche System verwirklicht werden konnte. Mit ihm wurde in der SBZ die Bildung und die Tätigkeit aller antifaschistischen Parteien erlaubt, »die sich die endgültige Ausrottung der Überreste des Faschismus und die Festigung der Grundlage der Demokratie und der bürgerlichen Freiheiten in Deutschland und die Entwicklung der Initiative und Selbstbetätigung der breiten Massen in dieser Richtung zum Ziele setzten«. Außerdem wurde die Tätigkeit von Gewerkschaften gestattet. Parteien und Gewerkschaften mußten sich bei den Organen der Selbstverwaltung und beim Militärkommandanten registrieren lassen. Ihre Tätigkeit sollte unter der Kontrolle der SMA und entsprechend den ihr gegebenen Instruktionen vor sich gehen.
20 c) Neugründung der KPD. Wiederum nur einen Tag später, am 11. 6. 1945, wandte 20 sich die KPD mit einem Aufruf an die deutsche Bevölkerung. Sie wurde repräsentiert vor allem durch eine kleine Gruppe von Emigranten, die von der sowjetischen Besatzungsmacht aus ihrem Exil in Moskau nach Berlin gebracht worden waren und unter der Führung von Walter Ulbricht standen. In ihrem Aufruf setzte sich die KPD für eine »anti-imperialistische Volksmacht in Form einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen Rechten und Freiheiten für das Volk« ein. Schon dieser Aufruf unterschied also zwischen Form und Inhalt. Der Form nach sollte der neue Staat eine parlamentarisch-demokratische Republik sein, dem Inhalt nach sollte er die »anti-imperialistische Volksmacht«,
also die politische Macht der Arbeiterklasse unter Führung ihrer Partei, verwirklichen.
21 d) Noch bevor andere Parteien in Erscheinung traten, wurde eine Dachorganisation geschaffen, in der das Bündnis der antifaschistischen Kräfte organisiert werden sollte. Am 14.7.1945 wurde der »antifaschistisch-demokratische Block« gegründet. Erst danach wurden drei weitere Parteien zugelassen: die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) am 17.6.1945, die Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDUD) am 26.6.1945 und die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD) am 5.7.1945.
Diese Parteien waren von Persönlichkeiten wieder ins Leben gerufen (SPD) oder neu gegründet worden (CDUD und LDPD), die sich zur parlamentarischen Demokratie bekannten, allerdings weitgehend andere Vorstellungen über den Inhalt der neuen Demokratie als die KPD hatten. Außerdem wurde am 15.6.1945 als einzige Gewerkschaftsorganisation der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) zugelassen, der nach anfänglichem Widerstand von CDUD und LDPD in den Block aufgenommen wurde.
Mit der SPD war neben der KPD eine zweite Arbeiterpartei zugelassen worden. Das widersprach zwar dem marxistisch-leninistischen Grundsatz, daß die Arbeiterklasse nur eine politische Partei haben dürfe, die ihre Vorhut bilde. Tatsächlich waren auch nach 1945 Bestrebungen vorhanden, eine einheitliche Arbeiterpartei zu bilden. Diese Bestrebungen gingen damals von der SPD aus. Jedoch versagte sich ihnen die KPD. Sie hatte aber das Ziel der Bildung einer Einheitspartei der Arbeiterklasse keineswegs aufgegeben. Sie wollte jedoch, daß diese einen marxistisch-leninistischen Charakter haben sollte. Deshalb beabsichtigte sie, zunächst einen eigenen Apparat mit geschulten und disziplinierten Funktionären aufzubauen, der bei einer späteren Vereinigung mühelos mit dem Apparat der anderen Arbeiterpartei fertig werden konnte. So kam es zunächst nur zu einer Aktionsgemeinschaft zwischen SPD und KPD. Die Zwangsvereinigung der SPD mit der KPD im April 1946 gehört einem späteren Stadium der Entwicklung an und erfolgte erst, als die KPD sich stark genug fühlte, auch gegen den Willen der übernommenen SPD-Funk-tionäre und -Mitglieder die neue Einheitspartei zu einer marxistisch-leninistischen Kampfpartei zu machen.
Die nichtkommunistischen Parteien waren also gleichsam in den Block hineingegründet worden (Ekkehard Krippendorf, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, S. 84). Die Zugehörigkeit war für deren Bestehen conditio sine qua non. Als ein aus der Notzeit geborenes und zu ihrer Überwindung unumgängliches Bündnis aller aufbauwilligen Kräfte konnte der Block auch von denen akzeptiert werden, die die Führung durch die KPD ablehnten. Erleichtert wurde ihnen die Mitarbeit im Block dadurch, daß in ihm alle politischen Kräfte gleichberechtigt sein und Beschlüsse nur einstimmig gefaßt werden sollten.
Indessen dominierte die KPD von Anfang an. Hinter ihr stand nämlich die Besatzungsmacht, mit der sie durch die gemeinsamen politischen und ideologischen Auffassungen eng verbunden war. Die Besatzungsmacht benutzte die KPD, um ihre Politik durchzusetzen. Was die KPD vorschlug, stand im Einklang mit dem, was die Besatzungsmacht wollte, und Widerstand gegen sie bedeutete Widerstand gegen die Besatzungsmacht mit allen Folgen, die ein solches Verhalten haben konnte. Trotzdem wurde er in den Anfangszeiten hin und wieder geleistet, wenn auch meist mit negativem Erfolg. Indessen konnten einige Male der KPD und damit der sowjetischen Besatzungsmacht Zugeständnisse abgerungen werden. Sie bezogen sich aber meist auf Randfragen und hielten die Entwicklung in der gewünschten Richtung nicht auf.
Der Block bildete einen Zentralen Ausschuß für die gesamte sowjetische Besatzungszone und Ausschüsse in den Ländern (Provinzen), Kreisen und Gemeinden. An den Sitzungen der Ausschüsse nahmen regelmäßig Offiziere der Besatzungsmacht als Beobachter teil. Die sowjetische Besatzungsmacht konnte so über die Blockausschüsse auch auf den mittleren und unteren Ebenen ihren Willen durchsetzen, ohne offen nach außen in Erscheinung zu treten. Sitz des Zentralen Blockausschusses war Berlin.
22 e) Erst nachdem die sowjetische Besatzungsmacht die Neugestaltung des politisch-gesellschaftlichen Lebens in ihrer Besatzungszone in die Wege geleitet hatte, wandte sie sich dem Aufbau von aus Deutschen bestehenden Organen zu. Deutsche Verwaltungen wurden zuerst auf örtlicher Ebene gebildet. Am 4. und 16.7.1945 wurden in Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Landes- bzw. Provinzialverwaltungen aus Persönlichkeiten gebildet, die von den entsprechenden Blockausschüssen vorgeschlagen waren (VOB1. der Provinzialverwaltung der Mark Brandenburg, S. 1; Regierungsblatt für das Land Thüringen I, S. 5; Amtliche Nachrichten der Landesverwaltung Sachsen, S. 3). Am 22.10.1945 ermächtigte die SMAD durch Befehl die Provinzial- und Landes Verwaltungen zur Normsetzung (Befehle des Obersten Chefs der SMAD 1945, Sammelheft I, S. 19). Gleichzeitig wurden Verordnungen, die diese schon vorher erlassen hatten, nachträglich legitimiert. Ein ausdrückliches Vetorecht behielt sich die Besatzungsmacht nicht vor. Es wurde nur grundsätzlich verfügt, daß die von den deutschen Verwaltungsorganen gesetzten Normen den Befehlen der Besatzungsmacht nicht widersprechen durften. Die Abhängigkeit der deutschen Landes- und Provinzialverwaltungen von der sowjetischen Militäradministration und den Blockausschüssen, in denen die KPD die Ziele der Besatzungspolitik vertrat, war aber so groß, daß ein Konflikt zwischen den deutschen Organen und der Besatzungsmacht über den Inhalt von Rechtsnormen undenkbar erschien und auch tatsächlich niemals entstand.
23 2. Deutsche Zentralverwaltungen
Die SMAD machte aber bei der Errichtung von deutschen Landes- und Provinzialorganen nicht halt. Am 27.7.1945, also noch während der Potsdamer Konferenz, verfugte sie durch den Befehl Nr. 17 die Errichtung von deutschen Verwaltungen in ihrer Besatzungszone mit Sitz in Berlin (Emst Deuerlein, Die Einheit Deutschlands, S. 345). Es wurden Deutsche Zentralverwaltungen für Verkehrswesen, Nachrichtenwesen, Brennstoffindustrie, Handel und Versorgung, Industrie, Land-und Forstwirtschaft, Finanzen, Gesundheitswesen, Arbeit und Sozialfürsorge, Volksbildung, Justiz, Umsiedlerfragen und später auch eine Deutsche Verwaltung des Innern gebildet. An ihrer Spitze standen Präsidenten. Die Zentralverwaltungen hatten zunächst die Aufgabe, die SMAD zu beraten. Sie hatten anfangs kein Weisungsrecht gegenüber den Landes- und Provinzialverwaltungen. Für alle ihre Handlungen waren sie der SMAD gegenüber verantwortlich.
24 3. SBZ wegweisend für ganz Deutschland?
Es gibt sichere Anzeichen dafür, daß die UdSSR die von ihr in ihrer Besatzungszone unternommenen Schritte zur Etablierung eines politisch-gesellschaftlichen und administrativen Systems in ihrem Sinne als wegweisend für ganz Deutschland ansah. Dafür spricht neben den Auslassungen der KPD aus der Zeit vor 1945 zunächst das schnelle Handeln der Besatzungsmacht, ferner, daß alle in der SBZ zugelassenen Parteien in ihrem Namen das Wort »Deutschland« führten und damit den Anspruch für eine gesamtdeutsche Betätigung erhoben. Die Deutschen Zentralverwaltungen waren als »Vorstufen zu den im Potsdamer Abkommen vorgesehenen gesamtdeutschen Staatssekretariaten gedacht« (Karl-Heinz Schöneburg/Karl Urban, Macht und Demokratie im revolutionären Prozeß des Übergangs zum Sozialismus, S. 712).
25 a) Für die Westmächte war ein unter Führung der KPD stehendes, nicht auf einer freien Willensentscheidung des deutschen Volkes beruhendes, zentralistisches System nicht annehmbar. Sie hatten von der Demokratie eine andere Vorstellung. Diese wird freilich als Streben nach »Restauration der imperialistischen Staatsmacht« (Roland Meister) gewertet. Wenn die Westmächte trotzdem den Formulierungen des Potsdamer Protokolls über die demokratische Neugestaltung zustimmten, so lag darin keinesfalls das Einverständnis mit einer Entwicklung nach den Vorstellungen der UdSSR. Ob diese den Westmächten überhaupt bekannt oder sie sich deren Tragweite bewußt waren, ist ungewiß. Es mag sein, daß sie sich über die Absichten der UdSSR täuschten oder täuschen ließen. Eine solche Täuschung lag nahe, weil die UdSSR gewisse äußere Formen wahrte, dabei insbesondere ein Mehrparteiensystem zuließ und darauf verzichtete, nach dem eigenen Muster ein Einparteiensystem einzuführen. Daß die UdSSR bei ihrem Vorgehen nach dem Zwei-Revolutionen-Schema verfuhr, demzufolge geschichtsnotwendig der sozialistischen Revolution eine bürgerlich-demokratische Revolution vorangehen muß, wenn die objektiven Voraussetzungen für eine sozialistische Revolution noch nicht vorliegen, sondern erst geschaffen werden müssen, lag offenbar entweder außerhalb des Gesichtskreises der Westmächte, obwohl beim Entstehen der Sowjetmacht in Rußland ebenso verfahren worden war, oder sie glaubten an eine Änderung der sowjetischen Auffassungen zumindest insoweit, als sie die Entwicklung außerhalb der Grenzen der UdSSR betrafen. Es kann aber auch nicht als ausgeschlossen gelten, daß die Westmächte darauf verzichteten, die gegensätzlichen Auffassungen in ihrer Tiefe auszuloten, um das nach außen gezeigte Einvernehmen nicht zu zerstören. So konnte die Einigung der an der Potsdamer Konferenz beteiligten Mächte nur in einer Formel bestehen, die, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 17. 8. 1956 [BVerfGE Bd. 5, S. 85 (KPD-Verbot)] zutreffend feststellte, nur darin bestand, das Bild des künftigen deutschen Staates so zu kennzeichnen, daß es sich deutlich von dem soeben beseitigten nationalsozialistischen System abhob. Für die künftige Entwicklung war diese Formel ohne Substanz, bedeutete daher auch keine Einigung über »allgemeine demokratische Grundbegriffe« (a. M. Werner Bracht, Potsdam heute, S. 351).
26 b) Andererseits konnte auch der UdSSR nicht unbekannt sein, daß ihre Auffassung von der künftigen Entwicklung in Deutschland nicht der der Westmächte entsprach. Auch sie verzichtete auf eine Klärung. Vielleicht gab sie sich der Illusion hin, daß auch die Entwicklung in den anderen Besatzungszonen früher oder später einen ähnlichen Verlauf nehmen würde, wie sie ihn in ihrer Besatzungszone eingeleitet hatte. Ihre Hoffnung mag sie dabei auf die KPD gesetzt haben, die sich bis zu ihrem Verbot im Jahre 1956 in Westdeutschland unbehindert betätigen konnte und in den ersten Jahren nach 1945 sogar an Landesregierungen beteiligt war. Indessen fand die KPD in Westdeutschland keine Bundesgenossen von politischem Gewicht, vor allem nicht bei der SPD, welche die sowjetischen Vorstellungen von der Entwicklung in Deutschland strikt ablehnte. Bei den Wählern fand die KPD in Westdeutschland so wenig Anklang, daß sie im Laufe der Zeit aus den meisten Parlamenten verschwand, weil sie die Fünf-Prozent-Klausel der Wahlgesetze nicht erreichen konnte. Die UdSSR mußte ihre Hoffnung auf die baldige Bildung einer »anti-imperialistischen Volksmacht« in Westdeutschland fahren lassen.
27 c) Ursächlich für die Spaltung Deutschlands waren also einerseits der von ideologischen Vorstellungen getragene Wille der UdSSR, in ganz Deutschland einer »antiimperialistischen Volksmacht« den Weg zu bereiten und einer marxistisch-leninistischen Partei die Neugestaltung der Verhältnisse in ganz Deutschland anzuvertrauen, und andererseits der Wille der Westmächte, Deutschland eine Ordnung zu geben, die ihren Vorstellungen von Demokratie entsprach.
Die UdSSR und ihr folgend der Verfassungsgeber der DDR betrachteten das Verhalten der Westmächte als einen Verstoß gegen die objektive Gesetzmäßigkeit der Geschichte und damit gegen die Interessen der deutschen Nation, weil es zur Herstellung von Verhältnissen in den westlichen Besatzungszonen führte, welche die Entscheidung über die weitere Entwicklung nicht von vornherein einer einzigen politischen Kraft überließen, sondern, freilich im Rahmen von Auflagen besonders hinsichtlich der föderativen Gestaltung Deutschlands, den Weg für eine eigene Entscheidung des deutschen Volkes über die Gestaltung von Staat und Gesellschaft eröffneten. In den Augen der Kommunisten mußte eine derartige Entscheidung freilich durch die kapitalistischen Kräfte beeinflußt werden, die nach ihrer Meinung in den Westzonen nicht nur nicht vernichtet, sondern sogar mit Hilfe der die Westmächte beherrschenden Kräfte restauriert wurden.
Wer freilich die Vorstellungen von der objektiven Gesetzmäßigkeit der Entwicklung vom Kapitalismus zum Sozialismus/Kommunismus und damit die Imperialismustheorie für nicht haltbar hält, weil sie komplexe und komplizierte Sachverhalte allzu vereinfachend monokausal erklären, muß zu einem anderen Ergebnis kommen. Er kann es nur auf die historischen Tatsachen abstellen, daß die UdSSR die Verhältnisse in ganz Deutschland nach ihren Vorstellungen gestalten wollte und daß, nachdem sich deren Scheitern am Willen des deutschen Volkes in den Westzonen und später in der Bundesrepublik Deutschland herausstellte, die UdSSR und ihre deutschen Gefolgsleute in ihrer Besatzungszone die Verhältnisse dort nach ihrem Willen gestaltet haben.
Die Spaltung wurde vertieft durch andere Faktoren, vor allem durch die Gegensätze, die sich im Laufe der Zeit zwischen der UdSSR und den Westmächten allenthalben, also nicht nur in der Deutschland-Frage, auftaten. Ob sie hätte beseitigt werden können, wenn die Westmächte auf die Angebote der UdSSR in ihrer Note vom 10. 3. 1952 und auf der Berliner Viererkonferenz im Jahre 1954 eingegangen wären, ist eine umstrittene Frage. Die Westmächte und die Bundesrepublik Deutschland vertraten den Standpunkt, daß auch diese Angebote von freien Wahlen in ganz Deutschland zur Herstellung der deutschen Einheit und das Verlangen der UdSSR nach einem Friedensvertrag mit Deutschland durch deren Willen auf Gestaltung der Verhältnisse in ganz Deutschland in ihrem Sinne belastet waren, durch einen Willen, der auch die Verhinderung engerer Verbindungen der Bundesrepublik an die Westmächte einschloß. Sie glaubten deshalb, auf die Vorschläge der UdSSR nicht eingehen zu können.
III. Die Entwicklung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung bis zur Gründung der DDR
28 Wenn die Ordnung, mit deren Errichtung in der SBZ bereits im Juni 1945 begonnen wurde, »antifaschistisch-demokratische Ordnung« genannt wird, obwohl sie im Sinne des Zwei-Revolutionen-Schemas äußere Formen einer bürgerlich-demokratischen Ordnung aufwies, so kommt in der Wahl der Bezeichnung zunächst zum Ausdruck, daß die neue Ordnung von Grund auf sich vom beseitigten nationalsozialistischen System unterscheiden sollte. Der Begriff »antifaschistisch-demokratische Ordnung« zeigt aber zugleich an, daß die neue Ordnung trotz gewisser äußerer Formen einen anderen Inhalt hatte als eine Ordnung, die die parlamentarische Demokratie für die Dauer erhalten wollte und sie dementsprechend sicherte. Trotz ihrer parlamentarisch-demokratischen Züge trug sie bereits die Keime für die weitere Entwicklung in sich. Dazu gehörte, daß die Parteien unter Führung der KPD in einem Block vereinigt waren, dementsprechend eine gemeinsame Politik verfolgen mußten, und daß das Entstehen einer Opposition mit der Chance, politischen Einfluß zu nehmen oder sogar die Politik in eine andere Richtung zu lenken, unmöglich war. Dazu gehörte ferner, daß von vornherein auf rechtliche Sicherungen zur Erhaltung der geschaffenen Ordnung verzichtet wurde. Deutlicher wurde das freilich erst später, als es darum ging, in den Landesverfassungen durch Bildung geeigneter Institutionen dieMöglichkeit zu schaffen, die Maßnahmen der öffentlichen Gewalt auf ihre Verfassungsmäßigkeit nachzuprüfen.
Die antifaschistisch-demokratische Ordnung wurde auf verschiedenen Ebenen weiter entwickelt.
29 1. Beginn der Umwälzung in der ökonomischen Basis
Die Umgestaltung der ökonomischen Basis wurde durch eine Umwälzung der Eigentumsverhältnisse in Angriff genommen. Es ging nach den kommunistischen Vorstellungen darum, den der Arbeiterklasse feindlich gegenüberstehenden Klassen der Großgrundbesitzer und der Kapitalisten die Basis ihre Existenz zu entziehen.
Zunächst wurde der Großgrundbesitz liquidiert. Dabei trat die Besatzungsmacht nicht offen in Erscheinung. Vielmehr erließen die von der Besatzungsmacht eingesetzten Landes- und Provinzialverwaltungen Verordnungen über die Bodenreform mit übereinstimmendem Inhalt [Sachsen: Verordnung über die landwirtschaftliche Bodenreform vom 10. September 1945 (Amtliche Nachrichten S. 27); Brandenburg: Verordnung über die Bodenreform in der Provinz Mark Brandenburg vom 6. September 1945 (VOB1. S. 8); Mecklenburg: Verordnung Nr. 19 über die Bodenreform im Lande Mecklenburg-Vorpommern vom 5. September 1945 (Amtsblatt der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern 1946, S. 14); Thüringen: Gesetz über die Bodenreform im Lande Thüringen vom 10. September 1945 (RegBl. I S. 13)] (Einzelheiten s. Rz. 12 zu Art. 9).
Auf dem Gebiete der gewerblichen Wirtschaft ging dagegen die Besatzungsmacht mit eigenen Befehlen vor. Durch den Befehl Nr. 124 vom 30.10.1945 (VOBl. der Provinz Sachsen Nr. 4/5/6, S. 10) wurde zunächst das Vermögen des Reiches und der Führer der Nationalsozialisten, der deutschen Militärbehörden und -Organisationen, der verbotenen Vereine, Klubs, Vereinigungen, der Regierungen und Staatsangehörigen der im Kriege auf deutscher Seite beteiligter Länder sowie von sonstigen Personen, die durch die SMAD bezeichnet wurden, beschlagnahmt. Durch den Befehl Nr. 126 vom 31.10.1945 (VOBl. der Provinz Sachsen Nr. 4/5/6, S. 12) wurde das Vermögen der NSDAP, ihrer Organisationen und der ihr angeschlossenen Verbände konfisziert. Das Vermögen der Banken und Versicherungen, die durch den Befehl Nr. OI vom 23.7.1945 (VOBl. der Provinz Sachsen Nr. 1, S. 16) geschlossen worden waren, wurde beschlagnahmt. Die beschlagnahmten oder konfiszierten Vermögenswerte wurden unter Enteignung der Eigentümer und sonstigen Berechtigten in Volkseigentum übergeführt [Befehl Nr. 97 der SMAD (VOB1. Provinz Sachsen 1946, S. 226) und landesrechtliche Normen: Sachsen: Gesetz über die Übergabe von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes vom 30. Juni 1946 (GVOB1. der Landesverwaltung Sachsen, S. 305); Sachsen-Anhalt: Verordnung betreffend die Überführung sequestrierter Unternehmen und Betriebe in das Eigentum der Provinz Sachsen vom 30. Juli 1946 (VOB1. S. 351); Brandenburg: Verordnung zur entschädigungslosen Übergabe von Betrieben und Unternehmungen in die Hand des Volkes vom 5. August 1946 (VOB1. S. 235); Mecklenburg: Gesetz Nr. 4 zur Sicherung des Friedens durch Überführung von Betrieben der Faschisten und Kriegsverbrecher in die Hände des Volkes vom 16. August 1946 (Amtsblatt S. 98); Thüringen: Gesetz betreffend die Übergabe von sequestrierten und konfiszierten Vermögen durch die SMA an das Land Thüringen vom 24. Juli 1946 (RegBl. I S. 111)] (Einzelheiten s. Rz. 11 zu Art. 9). Enteignet wurden nicht nur Kriegsverbrecher und aktive Nationalsozialisten. Es ging gar nicht um die politische Belastung der Eigentümer, sondern um die Enteignung der »Kapitalisten«. Der Befehl Nr. 64 der SMAD, mit dem die Enteignungen beendet werden sollten, erklärte erstmals, daß das Volkseigentum unantastbar und unveräußerlich sei (ZVOBl. 1948, S. 140). Ferner ergingen Enteignungsgesetze hinsichtlich spezieller Kategorien von Vermögenswerten [Bodenschätze und Bergwerke: Sachsen: Gesetz über die Überführung von Bergwerken und Bodenschätzen in das Eigentum des Landes Sachsen vom 8. Mai 1947 (GVOBl. S. 202); Sachsen-Anhalt: Gesetz über die Enteignung der Bodenschätze vom 30. Mai 1947 (GBl. DDR I 1947, S. 87); Brandenburg: Gesetz zur Überführung der Bodenschätze und Kohlenbergbaubetriebe in die Hand des Volkes vom 28. Juni 1947 (GVOB1. S. 15); Mecklenburg: Gesetz über die Enteignung von Bodenschätzen vom 28. Juni 1947 (RegBl. S. 143); Thüringen: Gesetz zur Überführung der Bodenschätze und der Bergbaubetriebe in die Hände des Volkes vom 30. Mai 1947 (RegBl. I S. 53). Lichtspieltheater: Sachsen: Gesetz zur Übernahme der Lichtspieltheater durch das Land Sachsen vom 10. Dezember 1948 (GVOBl. I S. 651); Sachsen-Anhalt: Gesetz betreffend Überführung der Lichtspieltheater in Gemeineigentum vom 4. Mai 1948 (GBl. I S. 73); Mecklenburg: Gesetz über die Übernahme einer Entschädigung für enteignete Lichtspieltheater-Unternehmer durch das Land Mecklenburg vom 18. September 1947 (RegBl. S. 249). Energiewirtschaft: Energiewirtschaftsverordnung vom 22. Juni 1949 (ZVOBl. I S. 472). Apotheken: Verordnung zur Neuregelung des Apothekenwesens vom 22. Juni 1949 (ZVOBl. I S. 487)].
30 2. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)
Auf politisch-gesellschaftlichem Gebiet wurde die Entwicklung entscheidend vorangetrieben durch die Vereinigung von SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). Das Verlangen nach Vereinigung ging von der KPD aus, die sich inzwischen stark genug fühlte, mit der SPD fertig zu werden. Indessen zeigte sich erheblicher Widerstand in der SPD. Dieser wurde jedoch mit Hilfe der Besatzungsmacht gebrochen. Die Vereinigung fand auf einem gemeinsamen Parteitag beider Parteien am 21.4. 1946 statt.
Die SED war nicht als ausgesprochene marxistisch-leninistische Partei gegründet worden, um unschlüssigen Funktionären der SPD die Zustimmung zu erleichtern. Bald jedoch bemächtigten sich die Funktionäre der ehemaligen KPD des Apparates der neuen Partei und verdrängten die ehemaligen SPD-Funktionäre. Dabei fand die KPD tatkräftige Unterstützung bei der Besatzungsmacht. Die ehemaligen Sozialdemokraten verschwanden nach und nach aus den Vorständen. So konnte die SED im Winterhalbjahr 1948/1949 zu einer Partei neuen Typus, zu einer marxistisch-leninistischen Kampfpartei umgewandelt werden (Statut der SED, angenommen auf dem III. Parteitag vom 20.-24.7.1950). Damit war aus der bisher zwar in der Praxis dominierenden, aber doch noch formal gleichberechtigten Partei die Kraft geworden, die eine Vorherrschaft (Suprematie) über alle anderen gesellschaftlichen Kräfte errang.
Nach Gerhard Schüßler (Die allgemeingültigen Lehren der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und ihre schöpferische Anwendung bei der Gestaltung der sozialistischen Staats- und Rechtsordnung in der DDR, S. 1023) waren Strategie und Taktik der KPD und der SED davon geprägt, daß die bürgerlich-demokratische Revolution unter den Bedingungen des Imperialismus zwei Etappen eines einheitlichen revolutionären Prozessesbildet, in dem die Arbeiterklasse von Anfang an die Rolle des Hegemons zu übernehmen hatte.
Gleichzeitig wurden in der CDUD und der LDPD die Kräfte ausgeschaltet, die sich der Vorherrschaft der SED widersetzten. Unbequeme Parteivorsitzende und die Inhaber anderer Parteiämter wurden mit Hilfe der Besatzungsmacht unter oft fadenscheinigen Vorwänden ihres Amtes enthoben und durch gefügige Personen ersetzt. Anläßlich der Auseinandersetzungen über das Ausmaß und die Art der Durchführung der Bodenreform wurden die Parteivorsitzenden der CDUD Andreas Hermes und Walter Schreiber Ende 1945 abgesetzt. Das zweite Mal verlor die CDUD ihre Führungsspitze, als die SMAD Jakob Kaiser und Ernst Lemmer die Ausübung ihres Amtes als Parteivorsitzende untersagte, weil sie sich nicht am Deutschen Volkskongreß (s.u.) beteiligen wollten. Auch die LDPD wurde von ähnlichen Führungskrisen nicht verschont.
Das Ensemble der Parteien wurde am 16. 6. 1948 durch die Zulassung der National-Demokratischen Partei Deutschlands (NDPD) und der Demokratischen Bauern-Partei Deutschlands (DBD) erweitert. Beide Parteien sind Tochtergründungen der SED.
Der 1945 gegründete FDGB geriet mehr und mehr unter den Einfluß der SED und erhielt so den Charakter einer »Massenorganisation« im marxistisch-leninistischen Sinne. Als weitere Massenorganisationen wurden zugelassen: der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands (KB), heute Kulturbund der DDR genannt, die Freie Deutsche Jugend (FDJ), der Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD), die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB), die Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion, später in Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft umbenannt (DSF).
31 3. Erste Wahlen und Landesverfassungen
Nachdem das Mehrparteien-System unter Führung der SED sich einigermaßen konsolidiert hatte und die entscheidenden Schritte zur Umwandlung der Eigentumsverhältnisse gemacht worden waren, wurden von der SMAD im Herbst 1946 die ersten Wahlen ausgeschrieben [Wahlordnung für die Gemeindewahlen in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands (VOBl. der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg 1946, S. 180); Wahlordnung für die Landtags- und Kreistagswahlen in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands (VOBl. Mark Brandenburg, S. 323)]. Gemeindewahlen fanden im Lande Sachsen am 1. 9. 1946, im Lande Thüringen und in der Provinz Sachsen-Anhalt am 8.9.1946, im Lande Mecklenburg und in der Provinz Brandenburg am 15.9.1946 statt. In der gesamten SBZ wurden Wahlen zu den Landtagen und Kreistagen am 20.10.1946 abgehalten.
Die Wahlen wurden nach dem Verhältniswahlrecht abgehalten. Allen »zugelassenen« Parteien und »antifaschistisch-demokratischen Organisationen« war das Recht gegeben, Wahlvorschläge einzureichen. Für die Beteiligung an den Gemeindewahlen war indessen nicht die allgemeine Zulassung für das gesamte Besatzungsgebiet maßgebend, sondern nur die örtliche. In vielen Gemeinden war indessen nur die SED zugelassen, weil die Registrierung von Ortsgruppen der CDUD und LDPD noch nicht erfolgt war. Diese Parteien konnten deshalb oft keine Wahlvorschläge einreichen. Außerdem wurde die SED im Wahlkampf von der Besatzungsmacht dadurch begünstigt, daß ihr wesentlich mehr Papier für den Druck von Wahlmaterial zugeteilt wurde. Bei der Genehmigung von Wahlversammlungen und Manuskripten von Wahlreden, die den örtlichen Kommandanten eingereicht werden mußten, wurde die SED eindeutig bevorzugt. Trotzdem errang die SED nicht den erwarteten Erfolg. In vielen Gemeinden, in denen die CDUD und die LDPD zugelassen waren, besonders in den Städten, erreichten diese beiden Parteien zusammen mehr Stimmen als die SED. Zwischen den Gemeindewahlen und den Landtags- und Kreistagswahlen verschärfte die SED den Wahlkampf bis zum Terror. Trotzdem gingen ihre Stimmen zurück. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg errangen die CDUD und LDPD zusammen sogar mehr Mandate als die SED, selbst unter Hinzuzählung der auf der Liste der VdgB gewählten Kandidaten, die ohne Ausnahme ebenfalls der SED angehörten. Die Wahlen des Jahres 1946 blieben in der SBZ daher die einzigen Wahlen, die nach getrennten Wahlvorschlägen durchgeführt wurden.
In den Ländern und Provinzen wurden in einer gewissen zeitlichen Staffelung Gemeindeordnungen [Gemeinde-Verfassung des Landes Mecklenburg vom 20. September 1946 (Amtsblatt S. 113); der Provinz Mark Brandenburg vom 14. September 1946 (GVOBl. 1947 II, S. 307); des Landes Sachsen vom 6. Februar 1947 (GVOBl. S. 54); der Provinz Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1946 (VOBl. S. 437); des Landes Thüringen vom 22. September 1946 (RegBl. I S. 138)] und Kreisordnungen [Kreisordnung für das Land Mecklenburg vom 13. Januar 1947 (RegBl. S. 9); des Landes Brandenburg vom 19. Dezember 1946 (GVOB1. 1947 I, S. 1); des Landes Sachsen vom 16. Januar 1947 (GVOBl. S. 22); des Landes Thüringen vom 20. Dezember 1946 (RegBl. 1947 I, S. 5); der Provinz Sachsen-Anhalt vom 18. Dezember 1946 (GBl. 1947 I, S. 16)] erlassen. Sie hatten alle etwa den gleichen Wortlaut. Mit ihnen wurde das parlamentarische System in die kommunale Verwaltung eingeführt. Als Exekutivorgane waren Räte zu wählen, die vom Vertrauen der örtlichen Volksvertretungen abhingen. Die Staatsaufsicht war der nächsthöheren Volksvertretung, in letzter Instanz den Landtagen übertragen. Für die Gemeinde galt das Prinzip der Universalität. Es wurde auch der traditionelle Unterschied zwischen Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten gemacht. Indessen fehlte ein Katalog, aus dem zu ersehen war, welche Angelegenheiten Selbstverwaltungsangelegenheiten und welche Auftragsangelegenheiten sein sollten. Dadurch war von Anfang an die Autonomie der Gemeinden nicht gesichert und der Keim für eine Zentralisation gelegt. Schon damals vertrat Ulbricht (Rede auf der kommunalpolitischen Konferenz in Werder am 23. und 24.7.1948) die Auffassung, daß die Selbstverwaltung in der neuen Ordnung sich von der Selbstverwaltung im herkömmlichen Sinne zu unterscheiden habe.
32 Die neugewählten Landtage beschlossen Landesverfassungen (RegBl. für das Land Thüringen 1947 I, S. 1; GBl. der Provinz Sachsen-Anhalt 1947 I, S. 9; RegBl. für Mecklenburg 1947, S. 1; GVOBl. der Provinzialregierung Mark-Brandenburg 1947, S. 45; GVOBl. der Landesregierung Sachsen 1947, S. 103). Grundlage war ein 32 einheitlicher Entwurf der SED. Trotzdem gelang es den anderen Parteien, einige, freilich nicht wesentliche Abänderungen durchzusetzen. Deshalb unterschieden sich die Landesverfassungen zwar nicht im Aufbau, aber in Einzelheiten. Die Provinzen Sachsen-Anhalt und Brandenburg nahmen die Bezeichnung »Land« an.
Die Landesverfassungen lehnten sich an die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11.8.1919 (Weimarer Reichsverfassung) an. Indessen wurden nunmehr die Landtage zum höchsten Organ erklärt. Die Verfassungen waren also bereits nach dem Prinzip der Gewalteneinheit gestaltet, wenn diese auch noch nicht konsequent durchgeführt war. In Sachsen-Anhalt wurde die Rechtsprechung von der Kontrolle durch den Landtag ausgenommen und nur die Justizverwaltung in sie einbezogen. Allerdings hatte diese Regelung wenig praktische Konsequenzen. Dagegen gelang es nicht, in der Verfassung von Sachsen-Anhalt ein Verfassungsgericht zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsnormen zu etablieren. Walter Ulbricht (Neues Deutschland vom 16.1.1947) rühmte sich, daß es der SED gelungen sei, den Versuch zur Beschränkung der Rechte des Parlaments durch die Schaffung eines Staatsgerichtshofes zu vereiteln. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, daß die »fortschrittlichste demokratische Ordnung« sich grundsätzlich von der »formal-demokratischen Ordnung« früherer Jahrzehnte unterscheide, weil das Parlament das höchste Machtorgan des werktätigen Volkes geworden sei und Regierung und Verwaltung nur ausführende Organe geworden seien und die Richter nicht über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen zu entscheiden hätten.
Die politische Verfassung wurde indessen durch die Existenz des antifaschistisch-demokratischen Blocks unter Führung der SED bestimmt. Alle Blockparteien waren an den Landesregierungen beteiligt. Jedoch nahm die SED die Schlüsselpositionen ein. Mit einer Ausnahme (Sachsen-Anhalt) stellte sie die Ministerpräsidenten. In allen Ländern gehörten die Innen- und Wirtschaftsminister dieser Partei an. In den Landtagen gab es keine organisierte Opposition. Trotzdem kam es in einigen Fällen zu Auseinandersetzungen zwischen den Parteien, sogar zu Kampfabstimmungen, wobei in Sachsen-Anhalt und Brandenburg in einigen, jedoch nebensächlichen Fragen die SED unterlag.
Das Verhältnis zwischen der Besatzungsmacht und den Ländern wurde nicht festgelegt. Diese begnügte sich damit, die Landesverfassungen zu bestätigen. Ein Vetorecht der Besatzungsmacht gegen Landesgesetze war auch nicht notwendig, denn sie verfügte über genügend andere Möglichkeiten, ihren Willen durchzusetzen. Vor allem benutzte sie dazu die Vorverhandlungen in den Blockausschüssen. Sie verschmähte auch nicht, persönlichen Druck auf widerstrebende Kräfte auszuüben.
33 4. Deutsche Wirtschaftskommission
Auf der zentralen Ebene wurde die Stellung der Deutschen Zentralverwaltungen nach und nach verstärkt. Ihre ursprüngliche Funktion, die Besatzungsmacht zu beraten, wurde auf die Kompetenz zur Koordinierung erweitert. Sie erhielten auch Vollmachten, in Finanz-, Wirtschafts- und Kulturfragen Anweisungen zu erteilen. Es blieb jedoch bei ihrer Weisungsgebundenheit an die SMAD und der Verantwortlichkeit ihr gegenüber.
Durch eine Vereinbarung zwischen den Landesregierungen und den Deutschen Zentralverwaltungen für Industrie, Brennstoff und Energie sowie für Handel und Versorgung vom 10. 2. 1947 wurde sodann festgelegt, daß diese Zentralverwaltungen bindende Anordnungen zur Koordinierung von Maßnahmen in den Ländern und Provinzen treffen durften. Am 4. 6. 1947 bildete die SMAD durch den Befehl Nr. 138 eine ständige Wirtschafts-Kommission (DWK) (Thüringische Rechtskartei Weimar 1947, S. 126). Sie bestand aus den Vorsitzenden von Zentralverwaltungen und den Vorsitzenden des FDGB und der VdgB. Außerhalb blieben die Verwaltungen des Innern, für Volksbildung und der Justiz, die die Bezeichnung »Deutsche Verwaltung des Innern«, »Deutsche Verwaltung für Volksbildung«, »Deutsche Justizverwaltung« erhielten.
Die eingegliederten Zentralverwaltungen wurden in Hauptverwaltungen der DWK umgebildet. Aufgabe der DWK war es, die Grundlagen für eine Wirtschaftsplanung der SBZ zu entwickeln.
Die Vollmachten der DWK wurden am 12.2.1948 erweitert, und ihre Zusammensetzung wurde neu bestimmt (Befehl Nr. 32 der SMAD) (ZVOBl. 1948, S. 89). Sie erhielt in einem beschränkten Umfang die Kompetenz, Normen zu setzen und wurde oberste Verwaltungsbehörde. Die DWK sollte die neugeschaffene volkseigene Wirtschaft organisieren und den ersten Wirtschaftsplan für die SBZ aufstellen.
Durch Befehl Nr. 183 der SMAD vom 27.11.1948 (ZVOBl. 1948, S. 139, 543) wurde die DWK abermals erweitert, indem in sie von den Landtagen gewählte und von den politischen Parteien und Massenorganisationen benannte Mitglieder aufgenommen wurden.
Die DWK bildete mit ihrem Apparat den Kern des späteren Verwaltungsapparates der DDR und war der Vorläufer der Regierung der DDR.
IV. Die Verfassung vom 7.10.1949
34 1. Vorgeschichte
Die SED unternahm schon früh den Versuch, Einfluß auf die verfassungsrechtliche Gestaltung Gesamtdeutschlands zu nehmen. Am 17. 11. 1946 veröffentlichte ihr Parteivorstand den Entwurf einer gesamtdeutschen Verfassung (Neues Deutschland vom 17.11. 1946, S. 3). Schon bald mußte sie indessen erleben, daß ihre Vorstellungen bei den verantwortlichen deutschen Organen in den Westzonen keinen Anklang fanden. Für den 6.6.1947 war nach München durch den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Erhard eine Konferenz der Ministerpräsidenten der deutschen Länder einberufen worden, zu der auch die Ministerpräsidenten der Länder in der SBZ eingeladen und erschienen waren. Schon am ersten Tage verließen diese jedoch die Konferenzen wieder, als sie feststellten, daß sie mit ihren zentralistischen Vorstellungen in der Minderheit waren. Sie handelten dabei zumindest in Übereinstimmung, wenn nicht auf Anweisung der sowjetischen Besatzungsmacht.
Am 26.11.1947 rief die SED alle deutschen Parteien und Organisationen zur Abhaltung eines »Deutschen Volkskongresses für Einheit und gerechten Frieden« auf. Aus Westdeutschland folgten nur die KPD und eine geringe Zahl von Einzelpersönlichkeiten.
Von den Parteien in der SBZ weigerte sich zunächst die CDUD, an dem Kongreß teilzunehmen. Nachdem ihre Vorsitzenden von der SMAD ihrer Posten enthoben worden waren, entschloß sich diese Partei unter dem Druck der Besatzungsmacht, am Kongreß teilzunehmen.
Der Kongreß trat am 6./7.12.1947 zu einer Sitzung zusammen, auf der die Einsetzung einer gesamtdeutschen Regierung verlangt wurde. Diese sollte so zusammengesetzt werden, daß die in der SBZ geschaffenen Verhältnisse auf ganz Deutschland übertragen werden konnten. Am 17./18.3.1948 trat ein »Zweiter Deutscher Volkskongreß« zusammen, der ähnlich wie der erste zusammengesetzt war. Dieser wählte einen »Deutschen Volksrat« mit dem Aufträge, eine gesamtdeutsche Verfassung auszuarbeiten. Inzwischen hatten sich die Spannungen zwischen den Besatzungsmächten soweit gesteigert, daß der Alliierte Kontrollrat am 20.3.1948 sich auf unbestimmte Zeit vertagte. Er ist seitdem nicht mehr zusammengetreten. Die Ausübung der obersten Gewalt in ganz Deutschland gemeinsam durch die vier Besatzungsmächte in Deutschland war damit beendet. Jedoch verblieb es dabei, daß die vier Zonenbefehlshaber jeweils in ihrer Zone die oberste Gewalt ausübten.
In seiner Sitzung vom 22.10.1948 bezeichnete sich der Deutsche Volksrat als die einzige legitime Repräsentation des deutschen Volkes und akzeptierte den geringfügig abgeänderten Verfassungs-Entwurf der SED, der dem Volke zur Aussprache zugeleitet werden sollte. Dabei gelang es der CDUD und der LDPD, weitere Änderungen durchzusetzen. Am 19.3.1949 verabschiedete der Deutsche Volksrat den Entwurf der Verfassung endgültig und legte ihn einem »Dritten Deutschen Volkskongreß« zur Billigung vor.
35 Der »Dritte Deutsche Volkskongreß« wurde auf eigenartige Weise zusammengesetzt. Am 15. und 16.5.1949 hatte der wahlberechtigten Bevölkerung der SBZ eine Einheitsliste Vorgelegen, zu der nur »Ja« oder »Nein« gesagt werden durfte. Die Einheitsliste hatte zwar Namen von Kandidaten aus allen in der SBZ zugelassenen Parteien (SED, LDPD, CDUD, NDPD, DBD) und Massenorganisationen (FDGB, DFD, FDJ, Kulturbund) enthalten. Indessen war kein Kandidat auf die Liste gesetzt worden, der nicht die Zustimmung aller im antifaschistisch-demokratischen Block zusammengeschlossenen Parteien, insbesondere also der SED, hatte. Die Stimmabgabe war nicht geheim. Als sich am ersten Wahltag gezeigt hatte, daß ein großer Teil der Wählerschaft nicht mit »Ja« gestimmt, sondern ungültige Stimmzettel abgegeben hatte, war in der Nacht zum 16.5.1949 von der »Deutschen Zentralverwaltung des Innern« eine Anordnung ergangen, in der die Wahlausschüsse auf diesen »Unfug« hingewiesen und angehalten wurden, wie es wörtlich hieß, »entsprechende Maßnahmen zu ergreifen«. Aus dem Lande Sachsen-Anhalt ist eine Anordnung des Innenministers bekannt, nach der sämtliche Wahlergebnisse auf Fehler zu untersuchen seien. Als »Ja«-Stimmen sollten alle Stimmzettel gelten, die keine Kennzeichnung hatten und auf denen nicht einwandfrei das Kreuz in den »Nein«-Kreis eingezeichnet war, selbst wenn auf dem Stimmzettel etwas anderes bemerkt oder bezeichnet worden war. Aus anderen Ländern wurde ähnliches berichtet. Bei der Auszählung waren schwere Wahlfälschungen begangen worden (Unrecht als System, Dokumente über planmäßige Rechtsverletzungen im sowjetischen Besatzungsgebiet, zusammengestellt vom Untersuchungsausschuß Freiheitlicher Juristen, herausgegeben vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, Teil I, Dokumente 200 bis 222). Trotzdem war das amtliche Wahlergebnis wenig überzeugend. Bei einer Wahlbeteiligung von 92,5% hatten nur 66,1% der Stimmen auf »Ja« gelautet, in Ostberlin sogar nur 51,6%.
Am 19.3.1949 stimmte der »Deutsche Volksrat« dem Verfassungsentwurf endgültig zu und übergab ihn dem »Dritten Deutschen Volkskongreß« zur Bestätigung. Diese erfolgte am 30.5.1949-
Am 7.10.1949 konstituierte sich der »Deutsche Volksrat« als provisorische Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik und setzte die Verfassung in Kraft [Gesetz über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7.10.1949 (GBl. DDR 1949, S. 4)]. Gleichzeitig bildete dieses Gremium eine provisorische Regierung [Gesetz über die Provisorische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7.10.1949 (GBl. DDR 1949, S. 2)].
Am 10.10.1949 wählten die Landtage die Vertreter für die Provisorische Länderkammer. Diese konstituierte sich am 11.10.1949. Am gleichen Tage wurde der Präsident der Republik (Wilhelm Pieck - SED) gewählt. Im Anschluß daran wurde die Provisorische Regierung bestätigt. Sie setzte sich zusammen aus dem Ministerpräsidenten (Otto Grotewohl - SED), 3 stellvertretenden Ministerpräsidenten (Walter Ulbricht - SED, Otto Nuschke - CDUD und Wilhelm Külz - LDPD) sowie 14 Fachministern, von denen 6 der SED, 3 der CDUD und je 1 der NDPD und der DBD angehörten. Ein Minister war parteilos.
Die SMAD übertrug am 10.10.1949 ihre Funktionen auf die Provisorische Regierung und wurde in eine Sowjetische Kontroll-Kommission (SKK) umgewandelt.
Am 12.10.1949 beschloß die Provisorische Volkskammer ein Gesetz zur Überleitung der Verwaltung [Gesetz zur Überleitung der Verwaltung vom 12.10.1949 (GBl. DDR 1949, S. 17)]. Darin wurde bestimmt, daß die Verwaltungsaufgaben des Vorsitzenden und des Sekretariats der DWK auf die Provisorische Regierung übergingen. Die Hauptverwaltungen der DWK wurden in die Ministerien mit entsprechendem Geschäftsbereich eingegliedert. Das gleiche geschah mit der »Deutschen Verwaltung des Innern«, der »Deutschen Verwaltung für Volksbildung« und der »Deutschen Justizverwaltung«. Alle sonstigen deutschen zentralen Verwaltungsorgane und Einrichtungen in der SBZ wurden den sachlich zuständigen Ministerien unterstellt. Die Provisorische Regierung wurde ermächtigt, die erforderlichen Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Die Verwaltungsorgane der Provisorischen Regierung, der Länder und der Selbstverwaltungskörperschaften wurden angewiesen, ihre Geschäfte zunächst nach den bisherigen Bestimmungen im Sinne der Verfassung weiterzufiihren.
36 Am Tage des Inkrafttretens der Verfassung vom 7.10.1949 wurde der »Deutsche Volkskongreß« in die »Nationale Front des demokratischen Deutschland« umgewandelt, eine Organisation, die in der Verfassung vom 6.4.1968 Verfassungsrang erhielt (s. Rz. 1-16 zu Art. 3). Daneben blieb der »Antifaschistisch-demokratische Block«, der später als »Demokratischer Block« bezeichnet wurde, bestehen.
37 2. Inhalt der Verfassung von 1949
Die SED war bei ihrem Entwurf davon ausgegangen, daß er die Grundlage für eine Verfassung Gesamtdeutschlands sein werde. Auch die Verfassungsdiskussion und die Beratung im »Deutschen Volksrat« und im »Deutschen Volkskongreß« wurden zunächst von dieser Vorstellung getragen. Erst als es nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 25.5.1949 [Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes (BGBl. S. 1)] klar geworden war, daß eine unter kommunistischem Einfluß entstandene Verfassung niemals für ganz Deutschland wirksam werden würde, wurde sie von einem Gremium, das sich nur in der SBZ betätigen durfte, formell in Kraft gesetzt und damit in ihrer Wirksamkeit auf deren Gebiet beschränkt. Jedoch wurde weder in der Präambel noch sonst an irgendeiner Stelle der Verfassung dieser veränderten Situation Rechnung getragen. In der Präambel wurde der Anschein erweckt, als ob das ganze deutsche Volk sich die Verfassung gegeben hätte. Im Gegensatz zum Bonner Grundgesetz kam in ihr ferner nicht zum Ausdruck, daß sie nur für eine Übergangszeit bis zur Wiederherstellung der Einheit Deutschlands gelten sollte.
Der Verfassungsgeber von 1949 hatte eine Entscheidung zugunsten eines parlamentarisch-demokratischen Systems mit föderalistischen und rechtsstaatlichen Zügen mit den entsprechenden Strukturelementen und -prinzipien getroffen. Bereits 1947 hatte Karl Polak (Marxismus und Staatslehre, S. 38) geschrieben, daß die Marxisten-Leninisten sich in der auf den ersten Blick paradoxen Lage befänden, für die Vollendung der bürgerlichen Demokratie zu kämpfen, »mit den bürgerlichen Parteien Hand in Hand auf einer gemeinsamen Plattform«. Derselbe Autor schrieb rückblickend im Jahre 1963 (Zur Dialektik in der Staatslehre, S. 409), heute wäre jedem einsichtig, daß und warum es absurd gewesen wäre, 1949 eine Verfassung (und auf ihrer Grundlage eine Staatsstruktur) zu schaffen, die auf der These aufgebaut wäre, es gelte die Entwicklungsgesetze des Sozialismus in der Praxis der Gesellschaft und jedes Gesellschaftsmitgliedes durchzusetzen.
38 Die Verfassung zeigte ebenso wie die Länderverfassungen starke Anklänge an die Weimarer Verfassung. Der Verfassungsgeber von 1949 meinte, wenn auch die Weimarer Verfassung erhebliche Mängel aufgewiesen hätte, hätte sie doch einen bedeutsamen Schritt auf dem Wege Deutschlands zu einer einheitlichen demokratischen Republik dargestellt und wesentliche Ansätze für den Ausbau eines demokratischen Staatswesens enthalten (Otto Grotewohl im Bericht des Verfassungsausschusses des Deutschen Volksrates am 22.10.1948).
Besonders in der Formulierung der Grundrechte bestand diese Ähnlichkeit. Klenner (Studien über die Grundrechte, S. 90) meinte, in der Grundrechtskonzeption der Verfassung sei der alte Dualismus zwischen Staat und Bürger nur zum Teil überwunden. Indessen baute sich die Grundrechtskonzeption der Verfassung sogar auf diesem Gegensatz auf. So war der Hauptteil B mit »Inhalt und Grenzen der Staatsgewalt« überschrieben. Grotewohl hatte zwar 1946 erklärt, die Grundrechte seien viel mehr als bloße Individualrechte, die der einzelne gegenüber dem Staat hätte, sie seien fundamentale Prinzipien der zukünftigen Staatspolitik. Indessen bekannte er sich in seiner Rede vor dem Deutschen Volksrat am 22.10.1948 zum hergebrachten Inhalt der Grundrechte, als er verkündete, die Staatsgewalt habe die persönlichen Freiheitsrechte des Bürgers zu respektieren und zu garantieren: die Gleichberechtigung vor dem Gesetz, die persönliche Freiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Versammlungsrecht, das Recht, Gesellschaften und politische Parteien zu bilden.
Die Verfassung baute sich auf dem Prinzip der Volkssouveränität auf und band die Staatsgewalt an die Grundsätze, die in der Verfassung zum Inhalt der Staatsgewalt erklärt wurden. Inhalt und Grenzen der Staatsgewalt wurden durch die Freiheitsrechte bestimmt. Ausdrücklich wurde verfügt, daß, soweit die Verfassung die Beschränkung eines der Grundrechte durch Gesetz zuläßt oder die nähere Ausgestaltung einem Gesetz vorbehält, das Grundrecht als solches unangetastet bleiben muß (Wesensgarantie). Eine ausdrückliche Unveränderlichkeitsgarantie für die Grundrechte enthielt die Verfassung freilich nicht.
Die Verfassung sah ein Mehrparteien-System vor. Für die Wahl wurde das Verhältniswahlrecht vorgeschrieben, dessen Verwirklichung nur bei Vorhandensein von mindestens zwei Kandidatenlisten möglich ist. Zu der Stellung der Abgeordneten enthielt die Verfassung die klassische Bestimmung, daß die Abgeordneten Vertreter des ganzen Volkes und nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden seien.
Neben dem Prinzip der Repräsentation des Volkswillens durch Volksvertretungen hatte die Verfassung eine plebiszitäre Komponente, da sie die Einrichtungen des Volksbegehrens und des Volksentscheides kannte.
Das Verhältnis von Regierung zu Volksvertretung war nach den für den Parlamentarismus üblichen Regeln gestaltet. Es galt also das Prinzip der parlamentarischen Verantwortlichkeit. Grotewohl hatte am 29.5.1949 vor dem »Dritten Deutschen Volkskongreß« ausdrücklich erklärt, daß der Verfassungsentwurf sich eindeutig und klar zur parlamentarischen Republik bekenne und sich bemühe, die entscheidende Rolle des Parlaments konsequent auszubauen.
Der Präsident der Republik hatte nur repräsentative Funktionen.
Die Verfassung gewährleistete die Selbstverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände, legte die Unabhängigkeit der Richter fest, die freilich nicht durch deren lebenslängliche Anstellung und Unabsetzbarkeit garantiert wurde, und enthielt im Hintergrund das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.
39 Indessen sind bedeutsame Unterschiede zur Weimarer Verfassung festzustellen. Vor allern bekannte sich die Verfassung zum Prinzip der Gewalteneinheit. Die Volkskammer, die Volksvertretung der gesamten Republik, wurde zum höchsten Organ erklärt. Eine Verfassungsgerichtsbarkeit sah die Verfassung nicht vor, dagegen eine Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Bedeutsame Unterschiede zur Weimarer Verfassung wurden für die Wirtschaftsordnung festgelegt. Im wirtschaftlichen Bereich wurden die Kollektivinteressen eindeutig den Individualinteressen übergeordnet. Die Verfassung sah eine Wirtschaftsplanung, jedoch nicht eine Planwirtschaft vor. Die Beschränkung des Eigentums war weitergehend als die der Weimarer Verfassung. Sein Inhalt und seine Schranken sollten sich »aus den sozialen Pflichten gegenüber der Gemeinschaft« ergeben. Die Verfassung bestätigte die Enteignungen, die im Zuge der Bodenreform und der Industriereform vorgenommen worden waren, und sah eine Bestandssicherung für das Volkseigentum vor. Das Volkseigentum war aber nach der Verfassung nur eine, wenn auch privilegierte Form des Eigentums neben dem Individualeigentum.
In der Regierungsbildung schlug sich das Blocksystem nieder. Alle Fraktionen der Volkskammer hatten das Recht, sich an der Regierung zu beteiligen. Die Verfassung sah aber dennoch die Möglichkeit vor, daß sich eine Fraktion von der Regierungsbildung ausschloß.
Die Stellung der Länder war wesentlich schwächer als nach der Weimarer Verfassung. Trotzdem waren sie an der Gesetzgebung der Republik durch eine eigene Vertretung, die Länderkammer, beteiligt. Nach der Verfassung hatten die Länder auch ein eigenes Recht zur Gesetzgebung, von dem sie freilich nach Inkraftsetzung der Verfassung nicht mehr Gebrauch machten. Die Verwaltung war im gewissen Umfange Sache der Länder. Die Länder waren also nicht lediglich Gebietskörperschaften höherer Ordnung, obwohl sie nur einen schmalen Restbereich von Funktionen hatten.
Die sozialen Grundrechte waren gegenüber der Weimarer Verfassung stärker ausgebaut.
Von den Strukturelementen und -prinzipien eines sozialistischen Staates (s. Rz. 25 u. 26 zu Art. 1) enthielt die Verfassung von 1949 also bereits den Grundsatz der Gewalteneinheit. Indessen war er durch die Garantie der Unabhängigkeit der Richter einerseits und durch den Rest der Eigenständigkeit der Länder und die Selbstverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände noch nicht restlos verwirklicht. Das Volkseigentum war trotz seiner privilegierten Stellung noch nicht Strukturelement.
40 Die Verfassung trug also den Charakter eines Kompromisses zwischen der SED, die eine mehr in ihrem Sinne liegende Fassung gewünscht hatte, und den politischen Kräften, die die parlamentarische Demokratie als beste Staatsform ansahen und sie deshalb als Dauerzustand wünschten. Das wurde im Jahre 1968 auch in der DDR eingeräumt (Karl-Heinz Schöneburg, Verfassung und Gesellschaft, unter Hinweis auf nicht veröffentlichte Protokolle des Verfassungsausschusses des »Deutschen Volksrates«).
Die SED hatte die Institution des Präsidenten der Republik, das Zwei-Kammer-System, die Wesensgarantie der Grundrechte und die Bindung der Staatsgewalt an die Grundsätze, die in der Verfassung zum Inhalt der Staatsgewalt erklärt sind, konzediert. Die anderen politischen Kräfte hatten auf das Prinzip der Gewaltenteilung in der Verfassung verzichtet und das Blocksystem bei der Regierungsbildung zugestanden.
Wie die weitere Entwicklung lehrte, waren aber gerade diese Zugeständnisse verhängnisvoll, denn sie erlaubten der SED, die Entwicklung in ihrem Sinne voranzutreiben, ohne den Widerstand von in der Verfassung vorgesehenen Institutionen fürchten zu müssen.
Trotzdem bleibt festzuhalten, daß die Verfassung von 1949 mit keinem Wort marxistisch-leninistischen Geist zum Ausdruck brachte. Wenn sie trotzdem in diesem Geiste ausgelegt wurde, so beruht das darauf, daß die Verfassung von den Trägern der politischen Gewalt in diesem Sinne ausgelegt wurde. Aus dem Text der Verfassung ergab sich ein Zwang zur Auslegung in diesem Geiste nicht. Die Wertentscheidungen des Marxismus-Leninismus waren für die Interpretation nicht verbindlich (a. M. Georg Brunner, J.f.O., S. 90).
V. Von der antifaschistisch-demokratischen Ordnung zur sozialistischen Umwälzung
41 1. Verfassungswirklichkeit
Die antifaschistisch-demokratische Ordnung behielt also auch nach Inkraftsetzen der Verfassung von 1949 ihr doppeltes Gesicht. Die Verfassung schrieb ein parlamentarisch-demokratisches System vor und enthielt föderalistische und rechtsstaatliche Züge. Die Verfassungswirklichkeit wurde jedoch weiter durch zwei Faktoren bestimmt, an deren Wirksamkeit auch das Inkrafttreten der Verfassung nichts änderte. Der eine war die oberste Gewalt der sowjetischen Besatzungsmacht, der andere das Blocksystem unter der Führung der SED. Der eine Faktor hing vom anderen ab. Das Blocksystem und insbesondere die Führung der SED darin waren eine Schöpfung der sowjetischen Besatzungsmacht.
Das doppelte Gesicht der antifaschistisch-demokratischen Ordnung wird auch im anderen Teil Deutschlands zugegeben. Karl-Heinz Schöneburg (Verfassung und Gesellschaft, S. 87, 191, 192) räumt ein, daß die Verfassung von 1949 in der damaligen Klassenkampfsituation darauf verzichtet habe, den Inhalt der Volkssouveränität von den die Staatsmacht bestimmenden Klassen her ausdrücklich zu reflektieren. Der Charakter des antifaschistisch-demokratischen Staates als Diktatur der Arbeiter-und-Bauern-Macht unter Beteiligung anderer Volksschichten - eine Bezeichnung für die »anti-imperialistische Volksmacht« in einem späteren Stadium - habe keine ausdrückliche Normierung in der Verfassung gefunden, er habe jedoch die gesellschaftliche und staatliche Wirklichkeit im Osten Deutschlands unverrückbar bestimmt. Es bestand also von Anfang an eine Diskrepanz zwischen dem Verfassungsrecht (der formellen Rechts Verfassung) und der Verfassungswirklichkeit, die Martin Drath (Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit ..., S. 33) treffend charakterisierte, wenn er feststellte:
»Die Verfassung, die >wirklich< gilt, ist größtenteils nur eine de-facto-Verfassung, keine Rechtsverfassung. Dem >formell gültigem< Verfassungsrecht fehlt die Geltungskraft in der Wirklichkeit, und dem wirklichen Verfassungsrechtfehlt die rechtliche Geltung.«
Im anderen Teil Deutschlands wird versucht, das Verhältnis zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit zu harmonisieren. Dabei bedient man sich einer geschichtsphilosophischen Rechtsdogmatik (Theodor Viehweg, Zwei Rechtsdogmatiken, S. 106ff.) teleologischer Art. Zu ihr führt die marxistisch-leninistische Staatstheorie, weil sie davon ausgeht, daß Staat und Recht nichts anderes seien als Ausdruck der die Geschichte bewegenden Kräfte, im Verhältnis von Ökonomie und Geschichte sekundäre Erscheinungen ohne eigenen Wert und selbständige Bedeutung. Eine solche Interpretation hält sich nicht an die Schranken, welche die Strukturelemente und -prinzipien, nach denen eine Verfassung gestaltet ist und die sich in ihren Normen niederschlagen, bestimmen. Sie interpretiert die Normen der Verfassung von der Wirklichkeit her ohne Rücksicht auf den geisteswissenschaftlich-phänomenologischen Inhalt der Begriffe, die sie verwendet. Auch sie hält sich an bestimmte Konstanten. Diese werden jedoch nicht aus den Normen der Verfassung gewonnen, sondern sind extrakonstitutionell. Die marxistisch-leninistische Staatstheorie gewinnt sie aus den Lehren des dialektischen und historischen Materialismus. Diese Interpretationsmethode verfährt also unjuristisch, solange die Verfassungsnormen die politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit nicht reflektieren. Wesentliche Teile der Verfassung von 1949 konnten so trotz formeller Geltung nicht zur faktischen Geltung kommen. Das gilt nicht nur für die Bestimmungen der Verfassung, die nur wirksam hätten werden können, wenn sie für ganz Deutschland formelle Geltungskraft erhalten hätten, sondern vor allem auch für die, welche eine parlamentarisch-demokratische Regierungsform und die Freiheit der Bürger gegenüber dem Staat verbürgen sollten.
Die Interpretation der Verfassung im marxistisch-leninistischen Sinne eröffnete der Verfassungsentwicklung eine Dynamik, die sich nicht durch das Verfassungsrecht gebunden hält. So meinte Alfons Steiniger (Wem mißfällt unsere Verfassung?, S. 7), die Verfassung von 1949 wäre keine erstarrte Programmkulisse und kein verworrenes Paragraphengestrüpp, sondern die gesetzmäßig (im Sinne der historischen Gesetzmäßigkeit) und in Gesetzesform sich weiter entwickelnde Grundlage des ganzen gesellschaftlichen Lebens, und nach Wolfgang Weichelt (Über die erste Etappe der Entwicklung des volksdemokratischen Staates in Deutschland, S. 148) bestand die vorwärtstreibende Bedeutung der Verfassung darin, daß sie der weiteren Entwicklung der Demokratie des werktätigen Volkes alle Tore öffnete und den Weg zum Aufbau des Sozialismus zeigte.
Wenn die Präambel der Verfassung von 1968 in bezug auf die Entwicklung den Begriff der Umwälzung verwendete (das Parteiprogramm der SED von 1963 sprach sogar von Revolution), so kommt damit das Gewaltsame, die Ungebundenheit an das Recht zutreffend zum Ausdruck. Obwohl der Eindruck erweckt werden soll, als ob die Entwicklung von den Volksmassen getragen wurde, stand jedoch eine echte Volksbewegung nicht hinter ihr. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte sie eingeleitet. Sie wurde von ihr und den von ihr geförderten deutschen Kräften vorangetrieben, ohne daß dem Volk die Möglichkeit gegeben wurde, unbeeinflußt seinen Willen zu äußern.
42 2. Wahl zur ersten Volkskammer
Ausdruck der durch die sowjetische Besatzungsmacht und die führende Stellung der SED bestimmten Verfassungswirklichkeit war bereits unmittelbar nach Inkrafttreten der Verfassung, daß die Wahl der Volkskammer nicht so bald wie möglich stattfand, sondern verschoben wurde. Auch die fälligen Wahlen zu den Landtagen, zu den Kreistagen und Gemeindevertretungen wurden verlegt und deren Legislaturperioden verlängert.
Ursächlich für diese Verschiebung war, daß die Führungen von CDUD und LDPD zunächst nicht bereit waren, die Wahlen nach einer Einheitsliste stattfinden zu lassen, wie es die SED forderte. CDUD und LDPD nahmen die Verfassung zunächst ernst.
Unter dem Druck der Besatzungsmacht kapitulierten indessen die Vorstände dieser Parteien und stimmten der Einheitsliste zu. Damit hatte die SED einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Es war nunmehr völlig klar geworden, daß ein parlamentarisch-demokratisches System, wie es die Verfassung vorschrieb, nicht verwirklicht wurde.
Im Wahlgesetz vom 9.8.1950 [
Gesetz über die Wahlen zur Volkskammer, zu den Landtagen, Kreistagen und Gemeindevertretungen in der Deutschen Demokratischen Republik am 15. Oktober 1950 vom 9.8.1950 (GBl. DDR 1950, S. 743)] wurde den Vereinigungen, die nach der Verfassung von 1949 das Recht hatten, Wahlvorschläge für die Volkskammer einzureichen, die Befugnis eingeräumt, gemeinsame Wahlvorschläge einzubringen. Im Zeichen des Blocksystems bedeutete diese Befugnis, daß auch von ihr Gebrauch zu machen war. So wurde den Wählern am 15.10.1950 nur eine von der Nationalen Front aufgestellte Liste vorgelegt. Die Liste war so zusammengestellt, daß auf ihr nur Kandidaten enthalten waren, die entweder von der SED benannt, oder, soweit sie von den anderen Parteien aufgestellt waren, von der SED gebilligt waren. So gab es weder eine Auswahl, noch war es möglich, die Summen der auf verschiedenen Listen abgegebenen Stimmen zueinander ins Verhältnis zu setzen. Gewählt war, wer von der Nationalen Front aufgestellt war. Die Volkskammer und die anderen Volksvertretungen waren damit so homogen zusammengesetzt, wie die SED es wünschte. Die Bildung einer Opposition war unmöglich gemacht.
Karl Urban (25 Jahre DDR ..., S. 1080/1081) charakterisierte die Entwicklung 1974 aus DDR-Sicht wie folgt:
»Mit der Gründung der DDR war der Staat der Diktatur des Proletariats noch nicht voll herausgebildet. Dies geschah erst durch den Sieg der Kandidaten der Nationalen Front bei den Volkswahlen im Jahre 1950. Die Durchsetzung und der Sieg der Einheitsliste der Nationalen Front zu diesen Wahlen bedeuteten eine neue Qualität der Führungsrolle der SED und der Arbeiterklasse, die vollständige Verwirklichung der Hegemonie des Proletariats in der Staatsmacht und im Bündnis mit allen Werktätigen.«
Über die homogen zusammengesetzte Volkskammer war es der SED auch möglich, die Regierung zu okkupieren, die aufgrund eines Gesetzes vom 8. 11. 1950 [Gesetz über die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vom 8.11.1950 (GBl. DDR 1950, S. 1135)] gebildet wurde.
Die Volkskammer war nur noch formell das höchste Organ. Die Regierung, später Ministerrat genannt, war bis zur Schaffung des Staatsrates im Herbst I960 de-facto zum höchsten Organ geworden, bei dem die Ausübung der Staatsgewalt konzentriert war.
Otto Grotewohl gab auf der 20. Tagung des ZK der SED (Neues Deutschland vom 11..9.1954) zu, daß bei der Bildung der Staatsorgane der Volkswille keine Rolle spielte, wenn er feststellte, daß die Arbeiter-und-Bauern-Macht Ausdruck der gesellschaftlichen Struktur - damit meinte er die Klassenstruktur im marxistisch-leninistischen Sinne - sei, nicht aber das Ergebnis einer Wahl.
Wolfgang Weichelt (In Geschichte und Gegenwart bestätigt, 60 Jahre Lenins Werk »Staat und Revolution«, S. 1037/1038) beschrieb 1977 den Charakter der Volksvertretungen der DDR so:
»In einigen volksdemokratischen Ländern, darunter auch in der DDR, mußte die Arbeiterklasse mangels solcher Organe (d. h. von Sowjets, d. Verf.) zunächst auf traditionelle parlamentarische Formen zurückgreifen. Charakteristisch aber ist es, daß in allen diesen Ländern die parlamentarischen Körperschaften von vornherein durch ihre Zusammensetzung eine anti-imperialistische, demokratische Orientierung erhielten und - was das Wesentliche ist - in einem jeweils unterschiedlichen langen Prozeß revolutionär-demokratischer Umgestaltung der Gesellschaft - in ihrer Struktur und in ihrer Arbeitsweise selbst einem Umgestaltungsprozeß unterworfen waren. In dessen Verlauf bildeten sich immer stärker die Wesenszüge sozialistischer Vertretungskörperschaften heraus. Es entwickelte und festigte sich die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei in diesen Organen; sie verbanden sich immer enger mit den werktätigen Massen, wurden zu Organen der Vereinigung und des Zusammenschlusses aller politischen Kräfte des werktätigen Volkes um die führende Arbeiterklasse; sie wurden zu Organen, mittels derer die Arbeiterklasse im Bündnis mit allen anderen werktätigen Klassen und Schichten erfolgreich die Aufgaben der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft realisiert.« (Ebenso: »Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie«, Lehrbuch, S. 179)
43 Die Verfassungswirklichkeit wurde maßgeblich beeinflußt durch die Existenz eines Ministeriums für Staatssicherheit, das durch Gesetz vom 8.2.1950 [Gesetz über die Bildung eines Ministeriums für Staatssicherheit v. 8.2.1950 (GBl. DDR 1950, S. 95)] gebildet worden war. Ihm wurde die Kompetenz übertragen, nicht nur alle politischen Regungen der Bevölkerung zu überwachen, sondern auch gegen »Staatsfeinde« einzuschreiten. Es schirmte die Entwicklung gegenüber Andersdenkenden ab und übernahm damit Funktionen, die bisher die Besatzungsmacht ausgeübt hatte. Es wurde zu einem Instrument des Terrors, dessen Inhaber der politischen Macht bedurften, um die Entwicklung in ihrem Sinne voranzutreiben.
Ferner verschaffte sich die herrschende politische Kraft das Informationsmonopol, indem sie sich der Massenkommunikationsmittel (Presse, Rundfunk, später Fernsehen) und aller Kultureinrichtungen (Theater, Film, Museen, Buch- und Kunstverlage) bemächtigte.
44 3. Volksdemokratische Ordnung
Damit war der Weg frei, um aus der antifaschistisch-demokratischen Ordnung eine sozialistische zu machen. Zuerst wurde indessen für die weiterentwickelte Ordnung der Begriff der volksdemokratischen Ordnung verwendet (s. Rz. 27 zu Art. 1).
Wann die antifaschistisch-demokratische Ordnung zu Ende ging und die volksdemokratische Ordnung begann, läßt sich nicht genau bestimmen. Der Übergang vollzog sich im Zuge eines allmählich fortschreitenden Prozesses, innerhalb dessen nur Marksteine der Entwicklung festgestellt werden können. Obwohl Otto Grotewohl in seiner Rede vom 22.10.1948 bestritt, daß in der DDR eine Volksdemokratie geschaffen werden sollte, meinte Fred Oelssner (Die Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, S. 30), daß mit der Gründung der DDR sich die Arbeiter-und-Bauern-Macht auf volksdemokratischer Grundlage gefestigt habe. Aber auch er meinte, es wäre falsch, beide Phasen scharf voneinander zu trennen, sie flössen ineinander über. Schon in der ersten Phase seien Aufgaben der sozialistischen Revolution gelöst worden. Dazu rechnet er die Bodenreform und die Überführung des größten Teiles der Industrie in Volkseigentum. Walter Ulbricht (Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, S. 408) sprach bereits 1952 von den volksdemokratischen Grundlagen der Staatsmacht. Das Parteiprogramm der SED von 1963 vermied in seinem historischen Teil die Angabe eines Jahres, in dem sich der Übergang vollzogen haben soll.
Ein wichtiger Markstein war die 2. Parteikonferenz der SED (9.-12.7.1952), welche die Schaffung der Grundlagen für den Aufbau des Sozialismus und eine völlige Zentralisierung der Verwaltung beschloß. Nach dem Parteiprogramm der SED von 1963 begann indessen die Schaffung der Grundlagen des Sozialismus bereits mit dem ersten Fünf-Jahr-Plan 1951. Nach Hans Leichtfuß/Karl-Heinz Schöneburg (Allgemeines, Besonderes und Einzelnes ...) ist in der Periode von 1949 bis 1953 die Staatlichkeit der antifaschistischdemokratischen Ordnung in der höheren Stufe der Arbeiter-und-Bauern-Macht als einer Form der Diktatur des Proletariats aufgehoben worden.
Auf dem V. Parteitag der SED (10.-16.7.1958) stellte Ulbricht fest, daß die Grundlagen des Sozialismus gelegt seien. Nunmehr müsse der Sozialismus zum Siege geführt werden. Auf dem VI. Parteitag (15.-21.1.1963) wurde sodann zwar nicht der Sieg des Sozialismus, aber der Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse verkündet. In dem auf diesem Parteitag beschlossenen Programm wurden bereits die Begriffe »sozialistische Staatsmacht« und »sozialistische Staatlichkeit« verwendet. Der sozialistische Staat war zu diesem Zeitpunkt bereits geschaffen.
45 4. Weitere Veränderung der ökonomischen Basis
Die Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse wurde nach Inkrafttreten der Verfassung von 1949 weiter vorangetrieben. Nach Abschluß der Enteignung von »Kriegsverbrechern und Naziaktivisten«, die noch bis in das Jahr 1950 weiterbetrieben wurde, gelangten sublimere Methoden zur Anwendung. Der volkseigene Sektor der gewerblichen Wirtschaft wurde durch Enteignungen unter Ausnutzung des Straf-, des Steuer-, des Zwangsvollstreckungs- und Konkursrechts, durch Entzug der Gewerbeerlaubnis sowie die Verweigerung von Material und Arbeitskräften oder durch den Entzug von Aufträgen innerhalb der geplanten Wirtschaft ausgebaut. Ferner wurden private Betriebe nach dem Muster der Volksrepublik China genötigt, staatliche Kapitalbeteiligungen aufzunehmen, was den Eigentümer zum Geschäftsführer des eigenen Betriebes degradierte. Private Handelsbetriebe mußten mit staatlichen Betrieben Kommissionsverträge vereinbaren, Handwerker wurden veranlaßt, sich in Produktionsgenossenschaften zusammenzuschließen.
Auf dem Gebiete der Landwirtschaft wurde ab 1952 der Zusammenschluß der bäuerlichen Betriebe zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gefordert. Im Jahre 1961 wurde er erzwungen. Das bäuerliche Eigentum wurde zum genossenschaftlich-kollektivwirtschaftlichen Eigentum, einer Form des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln.
46 5. Änderungen und Ergänzungen der Verfassung von 1949
Die Verfassung von 1949 wurde in der Zeit ihrer formellen Geltung in ihrem Text nur dreimal geändert und ergänzt. Durch Gesetz vom 6.10.1955 [Gesetz zur Ergänzung der Verfassung vom 26.9.1955 (GBl. DDR I 1955, S. 653)] wurden in die Verfassung die Bestimmungen über die Dienstpflicht zum Schutze »des Vaterlandes und der Errungenschaften der Werktätigen« aufgenommen. Das Gesetz vom 8.12.1958 [Gesetz über über die Auflösung der Länderkammer der Deutschen Demokratischen Republik vom 8.12.1958 (GBl. DDR I 1958, S. 867)] schaffte die Länderkammer ab. Durch das Gesetz vom 12.9.1960 [Gesetz über die Bildung des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 12.9.1960 (GBl. DDR I 1960, S. 505)] wurde als neues Staatsorgan, das anstelle des Präsidenten der Republik trat, der Staatsrat geschaffen.
Vorsitzender des Staatsrates wurde Walter Ulbricht, also der Erste Sekretär des ZK der SED, der damit das höchste Parteiamt und das höchste Staatsamt in seiner Hand vereinte (s. Rz. 10 zu Art. 69). Seine Machtfülle wurde dadurch komplettiert, daß er auch Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates war (s. Rz. 14 zu Art. 73).
47 6. Materielle Rechtsverfassung
Mit dem Fortschreiten der Umwälzung erging außerdem eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen, die anders als die Verfassung von 1949
die faktischen Machtverhältnisse reflektierten. Neben dem formellen Verfassungsrecht entstand so eine materielle Rechtsverfassung, in der die Strukturelemente und -prinzipien des sozialistischen Staates (s. Rz. 25, 26 zu Art. 1) mehr und mehr normiert wurden.
Dazu gehörte in erster Linie die Suprematie der SED (s. Rz. 28-50 zu Art. 1). Das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln (s. Erl. zu Art. 10) wurde aus einer Eigentumsart unter anderem zum Strukturelement. Das Prinzip des demokratischen Zentralismus (s. Rz. 7-14 zu Art. 2) wurde unter Beseitigung der Länder und der kommunalen Selbstverwaltung eingeführt. Die Gewalteneinheit (s. Rz. 21-32 zu Art. 5) wurde strikt verwirklicht. Nur die Normierung der sozialistischen Grundrechte (s. Erl. zu Art. 19) blieb zurück. Unter dem Aspekt des formellen Verfassungsrechts handelt es sich bei dieser Entwicklung um den Übergang von einer Verfassungsstruktur zu einer anderen. Gesetzliche Bestimmungen, die diesen Wandel bewirkten, waren:
(1) Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern der Deutschen Demokratischen Republik vom 23.7.1952 (GBl. 1952, S. 613);
(2) Gesetz über die örtlichen Organe der Staatsmacht vom 18.1.1957 (GBl. DDR Ⅰ 1957, S. 65, Ber. S. 120);
(3) Gesetz über die Rechte und Pflichten der Volkskammer gegenüber den örtlichen Volksvertretungen vom 18.1.1957 (GBl. DDR I 1957, S. 72, Ber. S. 120) und Gesetz zur Änderung des Gesetzes vom 17. Januar 1957 über die Rechte und Pflichten der Volkskammer gegenüber den örtlichen Volksvertretungen vom 20.9.1961 (GBl. DDR I 1961, S. 178);
(4) Gesetz über die Bildung des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 10.2.1960 (GBl. DDR I 1960, S. 89);
(5) Ordnungen über die Aufgaben und die Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe vom 28.6.1961 (GBl. DDR Ⅰ 1961, S. 52);
(6) Gesetz über die Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik (Verteidigungsgesetz) vom 20.9.1961 (GBl. DDR Ⅰ 1961, S. 175);
(7) Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die grundsätzlichen Aufgaben und die Arbeitsweise der Organe der Rechtspflege vom 4.4.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 21);
(8) Gesetz über den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik vom 17.4.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 89;
(9) Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Planung und Leitung der Volkswirtschaft durch den Ministerrat vom 11.2.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 1);
(10) Gesetz über die Wahlen zu den Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik (Wahlgesetz) vom 31.7.1963 (GBl. DDR Ⅰ 1963, S. 97), geändert durch Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wahlen zu den Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik - Wahlgesetz - vom 13.9.1965 (GBl. DDR Ⅰ 1965, S. 207) und durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wahlen zu den Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik - Wahlgesetz - vom 2.5.1967 (GBl. DDR Ⅰ 1967, S. 57);
(11) Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25.2.1956 (GBl. DDR Ⅰ 1965, S. 83);
(12) Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Neufassung des Erlasses über die Wahlen zur Volkskammer und zu den örtlichen Volksvertretungen der Deutschen Demokratischen Republik (Wahlordnung) vom 2.7.1965 (GBl. DDR Ⅰ 1965, S. 143);
(13) Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die Weiterentwicklung und Vereinfachung der staatlichen Führungstätigkeit in der zweiten Etappe des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung vom 14.1.1966 (GBl. DDR Ⅰ 1966, S. 53);
(14) Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik (Staatsbürgerschaftsgesetz) v. 20.2.1967 (GBl. DDR Ⅰ 1967, S. 3);
Die Übereinstimmung dieser Gesetze mit der Verfassung wurde ebenso mit Hilfe einer extensiven, jedoch unzulässigen Interpretation behauptet wie die Harmonisierung des Verhältnisses zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit. Außerdem behauptete man, daß sie rechtens seien, weil sie einstimmig von der Volkskammer angenommen worden waren, also mit einer größeren Mehrheit, als die Verfassung zu ihrer Änderung vorschrieb. Es schien hier das Problem des »verfassungdurchbrechenden« Gesetzes vorzuliegen, das die Staatsrechtswissenschaft schon während der Zeit der Weimarer Republik vielfach beschäftigte. Indessen vertraten schon damals auch die Staatsrechtslehrer, z. B. Gerhard Anschütz (Kommentar zur WRV, Anm. 2 zu Art. 76, Fußnote 1), welche der Auffassung waren, daß ein Gesetz, welches nicht mit der Verfassung übereinstimmt und den Wortlaut der Verfassung nicht ändert, aber mit der zu einer Verfassungsänderung notwendigen Mehrheit angenommen wurde, nicht gegen die Verfassung verstößt, die Meinung, daß es bedenklich, ja geradezu verwerflich sei, wenn das tatsächlich geltende Verfassungsrecht zu dem Verfassungstext mehr und mehr in Widerspruch gerate.
Der Widerspruch zum Verfassungstext änderte freilich nichts an der faktischen Geltung dieser Gesetze; denn die Verfassung kannte ja kein Organ, das unabhängig von den normsetzenden Organen eine Verfassungswidrigkeit verbindlich feststellen konnte.
48 7. Statut der SED als Teil der materiellen Rechtsverfassung
In materielles Verfassungsrecht erwuchs auch das Statut der SED, soweit es das Verhältnis dieser Partei zu den Staatsorganen festlegt. Zunächst war das Parteistatut der SED wie das Statut jeder anderen Partei zwar nur autonome Satzung. Nachdem aber die Suprematie der SED eine materiell verfassungsrechtliche Grundlage erhalten hatte, trat eine Änderung ein. Die Bestimmungen des Statuts waren, soweit sie das Verhältnis der Partei zu den Staatsorganen betrafen, nicht mehr nur Anweisung für die Parteimitglieder für ein bestimmtes Verhalten, sondern wurden allgemein verbindlich.
49 8. Veränderungen der materiellen Rechtsverfassung
Nachdem aus der DDR ein sozialistischer Staat geworden war, traten gewisse Veränderungen der materiellen Rechtsverfassung ein. Diese waren begründet mit dem Bestreben, die Funktionstüchtigkeit des Herrschaftssystems zu erhöhen (s. Rz. 15-19 zu Art. 2). Die Veränderungen betrafen insbesondere das Strukturprinzip des demokratischen Zentralismus und äußerten sich in einer Dekonzentration von Verwaltung und Wirtschaft (s. Erl. zu Art. 41). Außerdem wurden allenthalben Gremien mit der Funktion etabliert, Verwaltungs- und Wirtschaftsleiter durch Beratung zu unterstützen. Das konsultative Element gewann an Bedeutung (s. Rz. 33—41 zu Art. 5). Mit der Festigung des sozialistischen Staates trat auch eine Aufwertung des Rechts ein. Nachdem sich die faktischen Machtverhältnisse im materiellen Verfassungsrecht spiegelten, bestand das Bedürfnis, die Normen des materiellen Verfassungsrechts stabil zu halten.
50 9. Wahlen bis 1967
Nach dem Muster der Wahlen zu allen Volksvertretungen (Volkskammer, Landtage, Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen am 15.10.1950) fanden alle folgenden Wahlen statt. Es wurde bei den Wahlen ab 1965 geringfügig modifiziert. Die Volkskammer und die Bezirkstage wurden gewählt am 17.10.1954, am 16.11.1958, am 20.10.1963 und am 2.7.1967. Die Legislaturperiode der am 16.11.1958 gewählten Volkskammer und Bezirkstage wurde auf Beschluß des Staatsrates vom 19.10.1962 [Beschluß über die Verlängerung der laufenden Wahlperioden der Volkskammer und der Bezirkstage der Deutschen Demokratischen Republik vom 19.10.1962 (GBl. DDR I 1962, S. 91] um ein Jahr verlängert.
Die örtlichen Volksvertretungen (Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Stadtbezirksversammlungen) wurden gewählt am 23.6. 1957, am 6.7.1961 und am 10.10.1965. Infolge der ab 1952 vorgenommenen Strukturänderungen (Einführung des Prinzips des demokratischen Zentralismus) waren die 1953 fälligen Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen ausgefallen und erst abgehalten worden, nachdem mit dem Gesetz über die örtlichen Organe der Staatsmacht und dem Gesetz über die Rechte und Pflichten der Volkskammer gegenüber den örtlichen Volksvertretungen, beide vom 17.1.1957, die neue Organisation ihren vorläufigen Abschluß gefunden hatte.
Bei allen Wahlen wurde den Wählern keine Alternative geboten. Mit der Aufstellung der Kandidatenliste der Nationalen Front war bereits jedesmal entschieden, wer Abgeordneter einer Volksvertretung wurde. Das gilt auch für die Zeit ab 1965, in der auf der Vorschlagsliste mehr Kandidaten verzeichnet waren, als Abgeordnete zu wählen waren. Denn das Wahlrecht war so gestaltet, daß praktisch die Reihenfolge der Kandidaten auf der Vorschlagsliste über den Einzug in die Volksvertretung entschied (s. Rz. 1-14 zu Art. 22).
An den Wahlen nahmen jedesmal die Wahlberechtigten fast vollständig teil und gaben bis auf einen geringen Prozentsatz der Vorschlagsliste ihre Zustimmung. Trotzdem können diese Ergebnisse als Zustimmung der Wähler weder zur DDR als Staat noch zu der die DDR beherrschenden politischen Kraft gewertet werden. Wegen des Fehlens einer Alternative bestand nicht die Möglichkeit der Entscheidung zwischen verschiedenen politischen Richtungen. Ferner wurden bei den Wahlen stets alle Propagandamittel des Herrschaftssystems eingesetzt, um die Zustimmung der Wähler zu erlangen. Jede Gegenpropaganda war verboten. Außerdem wurde ein politischer Druck zur öffentlichen Stimmenabgabe ausgeübt.
Die Fluchtbewegung aus der DDR in die Bundesrepublik einschließlich Berlin (West), die erst mit dem Bau der Mauer in Berlin am 13.8.1961 als Massenerscheinung ihr Ende fand, aber trotzdem bis heute nicht völlig versiegt ist, sowie der Volksaufstand vom 17.6.1953 sind sichere Anzeichen dafür, daß in der Bevölkerung der DDR eine weitaus stärkere Gegnerschaft vorhanden war und noch ist, als durch die wenigen ablehnenden Stimmen bei den Wahlen reflektiert wurde.
Wie die Bevölkerung der DDR zu ihr und ihrem Herrschaftssystem steht und ob sie die marxistisch-leninistischen Wertvorstellungen übernommen hat, ist empirisch zur Zeit nicht feststellbar. Sicher ist, daß weite Teile sich der Not gehorchend angepaßt haben. Es wäre aber verfehlt, aus dieser Anpassung bereits auf eine innere Zustimmung zu schließen. Auch die Tatsache, daß ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung aktiv politisch tätig ist (jeder 55. der wahlberechtigten Bürger ist in einer Volksvertretung, drei Millionen Bürger sind ehrenamtlich in staatlichen oder gesellschaftlichen Funktionen tätig), sagt nichts übet die innere Zustimmung dieses Teils der Bevölkerung aus. Denn sie kann ebenfalls weitgehend mit Anpassung als Reaktion auf den politischen Druck erklärt werden. Indessen darf nicht verkannt werden, daß die Inhaber der politischen Macht sich bemühen, die Gesellschaft in das Herrschaftssystem zu integrieren. Ob es ihnen aber gelingt, die Integration so voranzutreiben, daß die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung die DDR als Staat und die in ihr ausgeübte politische Macht innerlich akzeptiert, ist eine offene Frage. Sie kann letztlich erst beantwortet werden, wenn der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben wird, sich frei für oder gegen die DDR als Staat und die sie beherrschende politische Kraft zu entscheiden.
51 10. Souveränitätserklärung
Je mehr sich das Herrschaftssystem der SED festigte, desto mehr konnte sich die sowjetische Besatzungsmacht weiter von einer offenen Einflußnahme zurückziehen. Am 25.3.1954 erklärte die Sowjetregierung die DDR für souverän und wandelte die SKK in eine Hohe Kommission um (Erklärung der Sowjetregierung über die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik vom 25. März 1954, in Herbert Krüger/Dieter Rau-schning, Die Gesamtverfassung Deutschlands, Frankfurt a. M.-Berlin, 1962, Dokument 12 I). Am 20.9.1955 bestätigten die UdSSR und die DDR vertraglich, daß die Beziehungen zwischen ihnen auf der Grundlage völliger Gleichberechtigung, gegenseitiger Achtung der Souveränität und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten beruhten [Vertrag über die Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 20.9.1955 (GBl. DDR Ⅰ 1955, S. 918)]. Die Hohe Kommission der UdSSR wurde durch eine Botschaft ersetzt, und die DDR entsandte einen Botschafter in die UdSSR.
Wegen der weiteren Entwicklung s. Rz. 66 zur Präambel, 15-22 zu Art. 6.
VI. Das Entstehen und der Charakter der Verfassung vom 6.4.1968
52 1. Vorbereitungen und Erlaß der neuen Verfassung
Das Fehlen einer formellen Verfassung, welche die bestehende Machtlage reflektiert, wurde auch in der DDR als unbefriedigend empfunden. Ab 1963 wurden Stimmen laut, die von einer neuen Verfassung sprachen. Eberhard Poppe und Rolf Schüsseler (Sozialistische Grundrechte und Grund-pflichten der Bürger, S. 228) machten im Februar 1963 Mitteilung von Vorbereitungen für eine neue Verfassung, die zwar noch nicht auf der Tagesordnung stehe, aber über kurz oder lang zu einer wichtigen Aufgabe werden würde. Im Sommer 1964 hatte, wie erst im Juni 1968 bekannt wurde (Hans-Joachim Semler, Vom Werden unserer sozialistischen Verfassung, Walter Ulbricht in einer Beratung seine Überzeugung geäußert, daß die Aufgabe, eine neue Verfassung auszuarbeiten, zwar immer mehr heranreife, aber ihre Inangriffnahme noch verfrüht sei.
Von einer kommenden »sozialistischen Verfassung« sprach bereits Anfang 1965 Gerhard Haney (Sozialistisches Recht und Persönlichkeit, S. 187), als er Schlußfolgerungen für die Formulierung der Grundrechte in ihr zog. Daraus kann geschlossen werden, daß schon damals Überlegungen über eine neue Verfassung angestellt wurden.
Offiziell kündigte sie Ulbricht auf dem VII. Parteitag der SED (17.-22.4.1967) an.
Am 2.5.1967 erklärte er vor der Volkskammer, daß jetzt wohl die Zeit für die Ausarbeitung einer neuen, zeitgemäßen Verfassung gekommen sei.
Über das Projekt drang indessen einige Monate lang nichts an die Öffentlichkeit. Es darf angenommen werden, daß innerhalb des Apparates des ZK der SED, besonders aber in der Abteilung Staats- und Rechtsfragen unter ihrem Leiter Klaus Sorgenicht intensive Vorarbeiten geleistet wurden, die zu einem Vorentwurf führten. Auf der 3. Tagung des ZK der SED (23.-24.11.1967) behandelte Ulbricht »Fragen des Staatsrechts«. Es ist sehr wahrscheinlich, daß er dabei den Vorentwurf für die Verfassung dem formell höchsten Gremium der SED unterbreitete.
Am 1.12.1967 gab Ulbricht dann eine längere Erklärung vor der Volkskammer ab (StuR 1968, S. 4, Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, vor der Volkskammer am 1. Dezember 1967 zur Ausarbeitung der sozialistischen Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik), in der er die Notwendigkeit einer neuen Verfassung begründete und vorschlug, eine Kommission der Volkskammer zur Ausarbeitung der neuen Verfassung einzusetzen (StuR 1968, S. 340, Begründung des Verfassungsentwurfs durch den Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, in der 7. Tagung der Volkskammer am 31. Januar 1968). Die Volkskammer beschloß entsprechend []
Beschluß der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik über die Bildung einer Kommission der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik zur Ausarbeitung einer sozialistischen Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 1.12.1967 (GBl. DDR 1967, S. 130)]. Der Kommission gehörten 40 Abgeordnete und 22 weitere Persönlichkeiten an. Den Vorsitz übernahm der Erste Sekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates, Walter Ulbricht, selbst. Zum Sekretär der Kommission wurde Klaus Sorgenicht bestellt.
53 Die Verfassungskommission legte am 31.1.1968 einen aus 108 Artikeln bestehenden Entwurf vor (StuR 1968, S. 445, Entwurf, Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, Vorgelegt von der Kommission zur Ausarbeitung einer sozialistischen Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 31. Januar 1968).
Dieser Entwurf wurde einer »Volksaussprache« unterbreitet. Sein Text wurde 7 Millionen Haushalten durch die Post zugestellt. Anfang Februar fanden Großveranstaltungen in allen Bezirken statt. In der Zeit vom 22. Februar bis Mitte März wurden weitere 232 »Bürgerkonferenzen« mit etwa 96 000 Teilnehmern abgehalten, in denen fast 3000 Personen ihre Meinungen vorgetragen haben sollen (Bericht der Verfassungskommission vor der Volkskammer, S. 697). Die Massenkommunikationsmittel verbreiteten in einer großangelegten Kampagne zustimmende Erklärungen zum Entwurf. Grundsätzliche Bedenken äußerten sieben evangelische Bischöfe, die am 15.2.1968 in einem freilich in der DDR nicht veröffentlichten Brief an den Staatsratsvorsitzenden darum baten, daß die neue Verfassung so gestaltet werde, »daß Christen und diejenigen Mitbürger, die die Weltanschauung der führenden Partei nicht teilen, an der Verantwortung für unser Staatswesen mit unverletztem Gewissen teilhaben können«. Sie betrachteten es als unerläßlich, daß in der neuen Verfassung die »volle Glaubens- und Gewissensfreiheit« ausdrücklich zugesichert würde. Es sei auch notwendig, die häufig wiederkehrende Formulierung »gemäß dem Geiste und den Zielen dieser Verfassung« durch klare rechtliche Bestimmungen zu ersetzen. »Geist und Ziele der Verfassung« wären mannigfacher Auslegung fähig. Außerdem lasse der Entwurf im Vergleich zu den Artikeln 40 bis 48 der Verfassung von 1949 eine Beschränkung des kirchlichen Lebens und unnötige Komplikationen im Verhältnis von Staat und Kirche befürchten (Evangelischer Pressedienst [epd] Nr. 63 vom 14.3.1968).
Am 24.3.1968 beriet die Verfassungskommission über einen Zwischenbericht zur Volksaussprache. Es wurde mitgeteilt, daß etwa 8000 Zuschriften mit vielfältigen Vorschlägen eingegangen seien. Die Zahl der Zuschriften erhöhte sich bis zur letzten Sitzung der Verfassungskommission auf 12 454.
Am 19.3.1968 tagte der »Demokratische Block«, in dem unter Führung der SED die Parteien und Massenorganisationen zusammengeschlossen sind, und gab seine prinzipielle Zustimmung zu den bisherigen Ergebnissen und dem weiteren Verlauf des Verfahrens.
Die Verfassungskommission legte am 26.3.1968 der Volkskammer einen überarbeiteten Entwurf vor, der gegenüber dem ursprünglichen Entwurf trotz der hohen Zahl der Zuschriften nur 118 Änderungen enthielt, welche die Präambel und 55 Artikel betrafen (Bericht der Verfassungskommission vor der Volkskammer, S. 697).
Die Volkskammer bestätigte diesen überarbeiteten Entwurf und unterbreitete ihn einem Volksentscheid aufgrund eines am gleichen Tage erlassenen Gesetzes [Gesetz zur Durchführung eines Volksentscheides über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 26. 3.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 192)]. Der Volksentscheid fand bereits 11 Tage später, am 6.4.1968, statt. Die Vorbereitungen wurden unter Einsatz aller Macht- und Propagandamittel des Herrschaftssystems getroffen. Nach dem am 8.4.1968 bekanntgegebenen Gesamtergebnis stimmten von 12 208 986 Stimmberechtigten 11 536 803 mit »Ja«, das sind 94,49%, und 409 733 mit »Nein«. Die Zahl der ungültigen Stimmen wurde mit 24 353 angegeben (Neues Deutschland vom 9.4.1968).
Die Voraussetzungen des Artikels 83 der Verfassung von 1949 und des § 10 des Gesetzes vom 26.3.1968, wonach der Entwurf angenommen ist, wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten zustimmt, waren damit formell erfüllt. Am 8.4.1968 verkündete der Vorsitzende des Staatsrates gemäß § 10 des genannten Gesetzes vom 26.3.1968 die neue Verfassung [Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6.4.1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 199)]. Sie trat nach Ablauf des Tages ihrer Verkündung, also am 9.4.1968, in Kraft.
Offensichtlich war eine so schnelle Verabschiedung der Verfassung nicht geplant. Das geht unter anderem daraus hervor, daß rechtswissenschaftliche Artikel zum Entwurf der Verfassung erst nach ihrem Erlaß erschienen (so z. B. im April- und Maiheft der Zeitschrift »Staat und Recht«, 1968). Über eine erweiterte öffentliche Sitzung des Instituts für Wirtschafts- und Arbeitsrecht der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft »Walter Ulbricht«, die am 15.2.1968 stattfand, berichtete die Zeitschrift »Arbeit und Arbeitsrecht« erst in dem Heft, das am 5.4.1968, also einen Tag vor dem Volksentscheid, ausgeliefert wurde (Harry Bredernitz/Alfred Baumgart, Der Verfassungsentwurf und die Weiterentwicklung des Arbeitsrechts, S. 164). Die auf dieser Sitzung geübte Kritik wurde nicht berücksichtigt. Offenbar hat die schnelle Verabschiedung der Verfassung entsprechende Korrekturen verhindert.
Die Gründe der Eile, mit der die Verfassung verabschiedet wurde, nachdem die DDR jahrelang mit einer Verfassung auskam, die sich nach Ansicht sogar der Inhaber der politischen Gewalt überlebt hatte, wurden nicht verlautbart. Es mag sein, daß die Entwicklung in der ÜSSR dazu beigetragen hat. Sie ließ eine schnellere Konsolidierung der verfassungsrechtlichen Verhältnisse in der DDR ratsam erscheinen.
54 2. Mediatisierung des Volkes bei Erlaß der Verfassung
Aus der Entstehungsgeschichte der Verfassung von 1968 folgt, daß das Volk der Deutschen Demokratischen Republik bei der Verfassungsgebung durch die SED als Inhaber der politischen Macht mediatisiert wurde. Der Volksaussprache kam allenfalls die Bedeutung einer Beratung zu, in der die Vorschläge aus der Bevölkerung - dazu sind auch
die Vorschläge der evangelischen Bischöfe zu rechnen - von der SED nach ihrem Ermessen angenommen oder verworfen wurden. Da die Volksabstimmung über die Verfassung sich in den gleichen Formen, in der gleichen Atmosphäre und unter den gleichen Begleitumständen vollzog wie die Wahlen seit 1950, ist ihr Ergebnis ebenso wenig wie das der Wahlen als eine auf freier Entscheidung beruhende Zustimmung des Volkes zu werten.
Die Verfassung von 1968 war allein das Werk der SED. Viele ihrer Sätze waren wörtlich oder nahezu wörtlich dem Parteiprogramm der SED von 1963 entnommen. Deren Vorstellungen setzten sich restlos durch. Im Gegensatz zur Verfassung von 1949 trug sie keinen Kompromißcharakter.
55 3. Keine grundlegend neuen Verhältnisse durch die Verfassung von 1968
Die Verfassung von 1968 schuf materiell-rechtlich keine grundlegend neuen Verhältnisse. In ihr schlug sich die materielle Rechtsverfassung nieder, wie sie bei Inkrafttreten der formellen Verfassung bis 1968 bereits bestand. Sie baut sich auf deren Strukturelementen und -prinzipien auf, berücksichtigt aber auch die neuen Elemente, die sich in deren Entfaltung seit 1963 zeigten (Dekonzentration, Verstärkung des konsultativen Elements, Aufwertung der Rolle des Rechts).
56 4. Gliederung der Verfassung
Die Verfassung ist gegliedert in eine Präambel und fünf Abschnitte. Abschnitt I enthält unter der Überschrift »Grundlagen der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung« das Kapitel 1: »Politische Grundlagen« (Art. 1-8) sowie das Kapitel 2: »Ökonomische Grundlagen, Wissenschaft, Bildung und Kultur« (Art. 9-18). Abschnitt II trägt den Titel: »Bürger und Gemeinschaften in der sozialistischen Gesellschaft«. Er enthält folgende Kapitel: Kapitel 1: »Grundrechte und Grundpflichten der Bürger« (Art. 19-40), Kapitel 2: »Betriebe, Städte und Gemeinden in der sozialistischen Gesellschaft« (Art. 41-43), Kapitel 3: »Die Gewerkschaften und ihre Rechte« (Art. 44-45), Kapitel 4: »Die sozialistischen Produktionsgenossenschaften und ihre Rechte« (Art. 46). »Aufbau und System der staatlichen Leitung« ist Abschnitt III überschrieben. Er umfaßt Art. 47 sowie Kapitell: »Die Volkskammer« (Art. 48-65), Kapitel 2: »Der Staatsrat« (Art. 66-77), Kapitel 3: »Der Ministerrat« (Art. 78-80), Kapitel 4: »Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe« (Art. 81-85). Abschnitt IV hat die »Sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtspflege« (Art. 86-106), Abschnitt V die Schlußbestimmungen zum Inhalt (Art. 107-108).
Die Verfassung von 1968 beginnt also nicht mit einem Katalog der Grundrechte, sondern mit Bestimmungen über die politischen, ökonomischen und geistig-kulturellen Grundlagen der Gesellschaft. Walter Ulbricht begründete in den Beratungen über den Verfassungsentwurf diese Gliederung damit, daß »Umfang, Inhalt und Effektivität der Grundrechte und -pflichten der Staatsbürger von den Gesellschaftsverhältnissen, den tatsächlichen Grundlagen der Gesellschaft bestimmt« würden (Hans-Joachim Semler, Vom Werden unserer sozialistischen Verfassung). Im Abschnitt über die Grundlagen der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung wird freilich auch »die neue Rolle und Stellung des Menschen in der Gemeinschaft gleichberechtigter und gleichverpflichteter Staatsbürger« fixiert. Damit wird im Aufbau der Verfassung das anthropologische Vorverständnis des Marxismus-Leninismus sichtbar, demzufolge der Mensch ein »vergesellschaftetes« oder »gesellschaftliches« Wesen ist (zum anthropologischen Vorverständnis insbesondere: Georg Brunner, Die Grundrechte im Sowjetsystem). Erst wenn die tatsächlichen Grundlagen der Gesellschaft, die Stellung und Rolle der Staatsbürger und ihrer Gemeinschaften in der Gesellschaft verfassungsrechtlich festgelegt seien, könne der Aufbau und das System der staatlichen Leitung festgelegt werden, meinte Ulbricht. So ist es im Aufbau der Verfassung geschehen. Insoweit ist die Gliederung der Verfassung von 1968 der der Verfassung von 1949 ähnlich, die gegliedert war in die drei Abschnitte: A. Grundlagen der Staatsgewalt, B. Inhalt und Grenzen der Staatsgewalt, C. Aufbau der Staatsgewalt.
Wenn die Verfassung von 1968 die »sozialistische Gesetzlichkeit und Rechtspflege« in dem besonderen Abschnitt IV regelt, so läßt sich bereits hieraus die Aufwertung der Rolle des Rechts erkennen. Die Aufnahme der Schlußbestimmungen in den besonderen Abschnitt V ist sinnvoller als die Gliederung in der Verfassung von 1949, in der die Übergangs- und Schlußbestimmungen unter X. dem Titel »C. Aufbau der Staatsgewalt« untergeordnet waren; denn die Schlußbestimmungen beziehen sich auf die Verfassung als Ganzes, nicht nur auf den letzten Abschnitt.
Wegen der relativen Kürze der Verfassung ist auch in ihr nicht alles enthalten, was die Verfassungsordnung bestimmt. Die Verfassung selbst verweist an manchen Stellen auf Gesetze, die ihren Inhalt weiter konkretisieren oder noch konkretisieren sollen (z. B. Art. 19, 85, 105, 106). Weitere gesetzliche Bestimmungen regeln oder konkretisieren die Verfassungsordnung über den Text der Verfassung hinaus, ohne daß der Text der Verfassung darauf einen ausdrücklichen Hinweis enthält.
Vor allem enthält die Verfassung keine Bestimmungen darüber, wie die SED als führende Kraft in Staat und Gesellschaft ihre Aufgaben erfüllt. Diese sind weiter nur in ihrem Statut enthalten.
Die Textexegese ergibt, daß die Terminologie häufig nicht exakt ist. So wurde die auf der erweiterten öffentlichen Sitzung des Instituts für Wirtschafts- und Arbeitsrecht der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft »Walter Ulbricht« vom 15.2.1968 vorgetragene Kritik an der Terminologie nicht berücksichtigt. Auch ist zuweilen Zusammengehöriges auseinandergerissen.
VII. Die staatsrechtliche Entwicklung seit dem VIII. Parteitag der SED
57 1. Lösung der Personalunion an der Spitze der SED und des Staates
Am 3.5.1971 wurde die Personalunion der Ämter des Ersten Sekretärs des ZK der SED, des Vorsitzenden des Staatsrates und des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates gelöst. Walter Ulbricht verlor seine Funktion als Erster Sekretär des ZK der SED und wurde zum »Vorsitzenden der SED« gemacht, ein Amt ohne Bedeutung, das im Parteistatut nicht vorgesehen war. Sein Nachfolger an der Spitze der SED wurde Erich Honecker. Dieser nahm auch seit Juni 1971 die Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates wahr, ohne daß dies jedoch publiziert wurde. In der konstituierenden Tagung der Volkskammer vom 26.11.1971 wurde Honecker offiziell zum Vorsitzenden des Staatsrates gewählt, während Ulbricht noch einmal zum Vorsitzenden des Staatsrates wiedergewählt wurde (Neues Deutschland vom 27.11.1971).
Der Zeitpunkt des Führungswechsels in der Partei war offensichtlich mit Rücksicht auf den bevorstehenden VIII. Parteitag der SED (15.6.-21.6.1971) gewählt worden. Die personellen Fragen sollten nicht erst auf dem Parteitag entschieden werden, sondern schon vorher gelöst sein.
58 2. Neue Phase der staatlichen Entwicklung nach dem VIII. Parteitag der SED
Den Beschlüssen des VIII. Parteitages wird zugeschrieben, eine neue Phase der staatlichen Entwicklung eingeleitet zu haben (Vorwort zur Textausgabe des Gesetzes über den Ministerrat, des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe sowie der Verordnung über Aufgaben, Rechte und Pflichten der volkseigenen Betriebe, Kombinate und WB, S. 7). Aus dem Bericht des ZK der SED an den Parteitag (Neues Deutschland vom 16.6.1971) geht Kritik an dem von Ulbricht geübten Führungsstil daraus hervor, daß der Wert der kollektiven Führung stark hervorgehoben wurde. In der Entschließung zum Bericht des ZK heißt es, es sei ein erstrangiges Anliegen der Partei, die Arbeit zur weiteren Festigung der sozialistischen Staatsmacht zielstrebig fortzuführen.
Das Leninsche Prinzip des demokratischen Zentralismus sei konsequent zu verwirklichen, indem die zentrale staatliche Leitung und Planung qualifiziert und wirksam mit der wachsenden schöpferischen Aktivität der Werktätigen verbunden werde. Volksvertretungen und Abgeordnete sollten ihre Funktionen noch vollständiger ausüben und ihren Einfluß auf solche Fragen verstärken, die die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger berühren. Die Einhaltung des sozialistischen Rechts und die bewußte Disziplin solle zur festen Gewohnheit der Menschen werden (Neues Deutschland vom 21.6.1971).
Aus der Staatspraxis ergab sich ein deutlicher Funktionsverlust des Staatsrates zugunsten des Ministerrates (Siegfried Mampel, Die staatsrechtliche Entwicklung in der DDR seit dem VIII. Parteitag der SED, S. 90-98). Dieser hielt auch an, nachdem Willi Stoph, bis dahin Vorsitzender des Ministerrates, am 3.10.1973 als Nachfolger des verstorbenen Walter Ulbricht zum Vorsitzenden des Staatsrates gewählt worden war (Neues Deutschland vom 4.10.1973).
59 3. Veränderungen in der einfachen Gesetzgebung
Ihren normativen Ausdruck fand die neue Entwicklung zuerst im Gesetz über den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik vom 16.10.1972 (GBl. DDR Ⅰ 1972, S. 253). Eng verzahnt mit diesem Gesetz sind zwei weitere Gesetzgebungsakte: das
Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe in der Deutschen Demokratischen Republik (GöV) vom 12.7.1973,
Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe in der Deutschen Demokratischen Republik (GöV) vom 12.7.1973 (GBl. DDR Ⅰ 1973, S. 313) und die Verordnung über die Aufgaben, Rechte und Pflichten der volkseigenen Betriebe, Kombinate und VVB vom 28.3.1973 (GBl. DDR Ⅰ 1973, S. 129), in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufgaben, Rechte und Pflichten der volkseigenen Betriebe, Kombinate und VVB v. 27.8.1973 (GBl. DDR I 1973, S. 405).
60 4. Veränderungen in der ökonomischen Basis
Die ökonomische Basis wurde im Jahre 1972 dadurch weiter umgestaltet, daß die Betriebe mit staatlicher Beteiligung, die im Jahre 1956 nach chinesischem Muster geschaffen worden waren (s. Rz. 8-11 zu Art. 14), sowie die privaten Betriebe in der Industrie in Volkseigentum übergeführt, also sozialisiert wurden. Nur im Binnenhandel und im Verkehrswesen gibt es seitdem noch einige Betriebe in den alten Eigentumsformen.
61 5. Verstärkung der Suprematie der SED
Die Lösung der Personalunion an der Spitze der SED und des Staates ließ den DDR-Verantwortlichen geraten sein, die Suprematie der SED stärker zu betonen. Das geschah nicht nur in der Fachliteratur (s. Rz. 28-50 zu Art. 1) und in der Propaganda, sondern auch in den Rechtsnormen. So wurde die führende Rolle der SED als Partei der Arbeiterklasse im Ministerratsgesetz von 1972 nicht weniger als achtmal aufgeföhrt. Es mehrten sich auch die Beschlüsse, die gemeinsam von höchsten Partei- und Staatsorganen gefaßt wurden (s. Rz. 23 u. 25 zu Art. 79).
62 6. Verfassungswandel und Verfassungsverstöße
Die staatsrechtliche Entwicklung seit dem VIII. Parteitag der SED bedeutete zweifellos, insbesondere was den Funktionsverlust des Staatsrates zugunsten des Ministerrates anbetrifft, einen Verfassungswandel. Ein solcher ist trotz des Bestandsschutzes, den die Verfassung sich selbst verliehen hat, verfassungsrechtlich nicht auszuschließen (s. Erl. zu Art. 106). Jedoch waren auch Verfassungsverstoße zu verzeichnen. So wurde auf der konstituierenden Sitzung der Volkskammer am 26.11.1971 entgegen dem klaren Wortlaut des Art. 80 Abs. 1 in der damals noch geltenden Fassung der Vorsitzende des Ministerrates aufgrund eines Vorschlages nicht des Vorsitzenden des Staatsrates, sondern des Ersten Sekretärs des ZK der SED im Namen des ZK und der Fraktion der SED in Übereinstimmung mit den anderen Fraktionen mit der Regierungsbildung beauftragt (Neues Deutschland vom 27.11.1971). Auch wurde entgegen Art. 70 Abs. 2 der damaligen Fassung seit dem VIII. Parteitag der SED die Volkskammer nicht mehr vom Staatsrat, sondern vom Präsidium der Volkskammer einberufen.
VIII. Die Verfassungsnovelle von 1974
63 1. Keine Totalrevision der Verfassung
Mit dem Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7.10.1974 (GBl. DDR Ⅰ 1974, S. 425) [die Verfassung wurde in der Fassung der Novelle neu verkündet (GBl. DDR I 1974, S. 432)] wurde der Text der Verfassung vom 6.4.1968 revidiert. Es handelt sich jedoch nicht um eine Totalrevision der Verfassung, weil eine solche des sozialistischen Typs mit allen Strukturelementen und -prinzipien, die diesem eigen sind, geblieben ist (a. A. Dietrich Müller-Römer, Die neue Verfassung der DDR, kommentierende Einleitung, S. 9).
64 2. Das Verfahren
Das Verfahren der Verfassungsrevision war eigenartig. Durch eine Meldung des Nachrichtenbüros der DDR »ADN« über die Tagesordnung der für den 27.9.1974 ein-berufenen 13. Tagung der Volkskammer erfuhr die Öffentlichkeit erstmalig, daß eine Verfassungsergänzung und -änderung geplant war. Die Meldung erschien erst am 26.9.1974, also nur einen Tag vor der Tagung, in der Tagespresse der DDR (z. B. Neues Deutschland vom 26. 9. 1974). Schon das war ungewöhnlich; denn im allgemeinen liegt zwischen der Pressemeldung über die Einberufung und der Tagung der Volkskammer ein größerer zeitlicher Abstand.
Dem Bericht über die Sitzung der Volkskammer in der Presse (z.B. Neues Deutschland vom 28.9.1974) ist zu entnehmen, daß sich der Verfassungs- und Rechtsausschuß der Volkskammer mit dem Entwurf befaßt und seine Annahme empfohlen hatte. Dem Entwurf der Novelle lag ein gemeinsamer Entwurf aller Fraktionen zugrunde. Eine Aussprache vor dem Plenum fand nicht statt. Lediglich der Erste Sekretär des ZK der SED, Erich Honecker, begründete den Entwurf. Vor der Abstimmung stellte der Präsident der Volkskammer die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Abgeordneten fest. Im Ergebnis der Abstimmung konstatierte er, daß das Gesetz einstimmig angenommen war und daß damit die Erfordernisse einer Verfassungsänderung gemäß Art. 63 und 108 der Verfassung erfüllt waren. Eine zweite Lesung fand nicht statt. Das Gesetz wurde im Gesetzblatt noch am selben Tag verkündet. Abweichend von dem sonst geübten Brauch trägt es nicht das Datum seiner Annahme, sondern das vom »7. Oktober 1974«, des Tages der 25. Wiederkehr des Inkraftsetzens der ersten DDR-Verfassung vom 7.10.1949, also des Gründungstages der DDR.
Erst drei Monate später erfuhr die Öffentlichkeit am 13.12.1974 (z. B. Neues Deutschland vom 13.12.1974) durch den auf der 13. Tagung des ZK der SED (12.12.-14.12.1974) erstatteten Bericht des Politbüros, daß dem ZK auf seiner 12. Tagung (4. und 5.7.1974) Vorschläge über die Ergänzung und Änderung der Verfassung Vorgelegen hatten und daß das Politbüro darüber mit den Vorsitzenden der »befreundeten« Parteien und Massenorganisationen beraten hatte. Aus dem Material, das über die 12. Tagung des ZK der SED veröffentlicht worden war, war das freilich nicht zu ersehen gewesen. Diskretion und Eile kennzeichneten das Verfahren. Art. 65 Abs. 4 in der Fassung von 1968, demzufolge Entwürfe grundlegender Gesetze vor ihrer Verabschiedung der Bevölkerung zur Erörterung unterbreitet werden müssen und die Ergebnisse der Volksdiskussion bei der endgültigen Fassung auszuwerten sind, wurde nicht angewendet. Über die Gründe wurde nichts verlautbart. Über sie können nur Mutmaßungen angestellt werden. Als wahrscheinlich kann aber gelten, daß bei einer öffentlichen Diskussion auch die Behandlung einer der Punkte der Verfassungsänderung nicht zu umgehen gewesen wäre: die Frage der deutschen Nation und die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands (s. Rz. 65 zur Präambel).
65 3. Grundsätze der Verfassungsrevision
Einzelheiten der Verfassungsrevision werden an den einschlägigen Stellen dieses Kommentars erläutert. Hier ist auf die Grundzüge einzugehen.
Nach Gert Egler/Hans-Dietrich Moschütz (Zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der DDR, S. 359) ist die »verfassungsrechtlich präzisere Widerspiegelung des Klassenwesens unseres Staates und seiner Politik« »der Angelpunkt« der Verfassungsrevision. Sie fahren fort:
»In Verbindung mit der Neufassung der Präambel ist verfassungsrechtlich damit die in der Wirklichkeit vollzogene Tatsache zum Ausdruck gebracht, daß in der DDR sowohl von den inneren als auch von den äußeren Bedingungen und Positionen her der Sieg der sozialistischen Gesellschaftsordnung unwiderruflich und endgültig ist.«
Weil es zweifelhaft erscheint, ob die Unwiderruflichkeit des Sieges des Sozialismus in der DDR verfassungsrechtlich noch deutlicher gemacht werden mußte, als das bereits in der Verfassung von 1968 geschehen war, liegt der Schluß nahe, daß die Erläuterung von Egler/Moschütz auf ihren eigentlichen Sinn hin untersucht werden muß. Dabei ergibt sich, daß damit zunächst die Tilgung des Begriffs »deutsche Nation« und des Verfassungsauftrages in Art. 8 Abs. 2 a. F. (normale Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten, Überwindung der Spaltung Deutschlands, Annäherung der beiden deutschen Staaten bis zur Vereinigung auf der Grundlage der Demokratie und des Sozialismus) gemeint sind (s. Rz. 4-8 zur Präambel). Damit hatte die Abgrenzungspolitik der DDR-Ver-antwortlichen ihren verfassungsrechtlichen Ausdruck gefunden. Weiter ist aber auch das gemeint, was Gerhard Schüßler (Partei, Staat und Recht in der sozialistischen Gesellschaft, S. 1962) als die »Fixierung der Unwiderruflichkeit des Bündnisses der DDR mit der UdSSR« bezeichnet (s. Rz. 15-22 zu Art. 6). Als weiteren Grundzug nennt Schüßler die verfassungsrechtliche Festlegung der sogenannten Hauptaufgabe, wie sie auf dem VIII. Parteitag beschlossen worden war (weitere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums der Arbeitsproduktivität, s. Rz. 20-25 zu Art. 2). Hervorzuheben ist ferner, daß durch die Verfassungsnovelle Teile des Gesetzes über den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik vom 16.10.1972 (GBl. DDR Ⅰ 1972, S. 253) in Verfassungsrang erhoben wurden. Damit wurde die neue Kompetenzverteilung zwischen Ministerrat und Staatsrat konstitutionell festgeschrieben. Bei dieser Gelegenheit wurde formell auch die Stellung der Volkskammer gestärkt, ohne daß diese aus ihrem Schattendasein herausgehoben worden wäre.
IX. Die Entwicklung bis Anfang 1978
66 1. Neuer Bündnisvertrag mit der Sowjetunion
Die verfassungsrechtliche Unwiderruflichkeit des Bündnisses mit der UdSSR fand ihren bilateralen Ausdruck in dem neuen Vertrag über Freunschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 5.12.1975 (GBl. DDR ⅠⅠ 1975, S. 238). (Wegen der Entwicklung des Verhältnisses zur UdSSR bis dahin im einzelnen s. Rz. 15-22 zu Art. 6).
Dieser Bündnisvertrag bestätigte das Sonderverhältnis zwischen der Sowjetunion und der DDR, das als ein Protektorat neuen Typs, also als ein Verhältnis zwischen einer Schutzmacht und einem Schutzgebiet, dessen Organe formelle Selbständigkeit genießen und auch, soweit die Schutzmacht dies zuläßt, materielle Selbständigkeit zeigen dürfen, zu bezeichnen ist.
Er machte abermals deutlich, daß das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und der DDR ganz nahe an der Trennungslinie zwischen Völkerrecht und Staatsrecht steht. Die Bindung der DDR an die Sowjetunion ist jetzt so eng, daß dieses Verhältnis zu den Strukturelementen der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung der DDR zu rechnen ist. Auch das Lehrbuch »Staatsrecht der DDR«, das vom Minister für Hoch- und Fachschulwesen als solches für die Ausbildung bzw. Weiterbildung an den Universitäten und Hochschulen der DDR anerkannt ist, nennt dieses Bündnis ein »Wesensmerkmal« der Verfassung der DDR (S. 40) (s. Rz. 26 zu Art. 1).
67 2. Neues Parteistatut als materielles Verfassungsrecht
Der IX. Parteitag des SED (18.5.-22.5.1976) war verfassungsrechtlich insofern von Bedeutung, als auf ihm außer dem neuen Programm auch ein neues Statut verabschiedet wurde. In den Teilen, in denen es das Verhältnis zwischen den Parteiorganen einerseits und den Staatsorganen andererseits regelt, ist es nunmehr anstelle des alten Statuts Bestandteil der materiellen Rechtsverfassung der DDR geworden (s. Rz. 48 zur Präambel).
Der Erste Sekretär des ZK der SED führt seitdem den Titel Generalsekretär. (Wegen der weiteren Änderungen s. Rz. 33-39 zu Art. 1).
68 3. Wiederherstellung der Personalunion an der Spitze der SED und des Staates
Die am 17.10.1976 neu gewählte Volkskammer wählte in ihrer konstituierenden Tagung am 29.10.1976 den Generalsekretär des ZK der SED, Erich Honecker, zum Vorsitzenden des Staatsrates. Damit war die Personalunion zwischen dem höchsten Partei- und dem höchsten Staatsamt wiederhergestellt. Gleichzeitig wurde Erich Honecker wieder zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates gewählt. Willi Stoph, bis dahin Vorsitzender des Staatsrates, wurde wiederum Vorsitzender des Ministerrates (Ministerpräsident) (Neues Deutschland vom 30./31. 10. 1976). Äußerlich war damit die Machtkonstellation wiederhergestellt, wie sie zu Ulbrichts Zeiten bis zum 3.10.1973 bestanden hatte. Die neue Verteilung der Kompetenzen zwischen Staatsrat und Ministerrat, wie sie durch die Verfassungsnovelle 1974 bestätigt worden war, blieb jedoch unverändert.
Auch in der Verfassungswirklichkeit hat Erich Honecker nicht die Machtstellung Ulbrichts zur Zeit der Personalunion erreicht. Folgte die Wiederherstellung der Personalunion in der DDR auch dem Beispiel der Sowjetunion, so hat doch Honecker nicht die beherrschende Stellung erlangen können, die Breschnew offenbar in seinem Lande einnimmt.
Innerhalb des Politbüros des ZK der SED als dem faktisch mächtigsten Organ in der DDR, erscheint Honecker nach außen als primus inter pares. Wie die Verhältnisse faktisch sind, wird man, wie üblich, erst nach erfolgten Personalveränderungen erfahren können. Auf jeden Fall ist aber der sowjetische Einfluß auf die Personalpolitik und damit auch auf die Machtverteilung innerhalb der Partei- und Staatsführung der DDR der letztlich ausschlaggebende Faktor. Das ergibt sich aus der Stellung der DDR als eines Protektorats neuen Typs der Sowjetunion.
69 4. Keine innerstaatlichen Auswirkungen durch Grundlagenvertrag
Die nach dem Abschluß des Vertrages über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland vom 21. Dezember 1972 (Grundlagenvertrag), der von der DDR am 13.6.1973 (GBl. DDR ⅠⅠ 1973, S. 26) ratifiziert worden war, einsetzende weltweite Anerkennung der DDR als Staat (s. Rz. 61 zu Art. 1) hat für die Verfassungswirklichkeit der DDR keine spürbaren Auswirkungen gehabt. Die von manchen erhoffte Liberalisierung des Herrschaftssystems trat nicht ein.
70 5. Keine innerstaatlichen Auswirkungen durch Schlußakte von Helsinki und Menschenrechtskonvention der UN
Dasselbe gilt für die Unterzeichnung der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vom 1.8.1975 durch die DDR und die Ratifikation der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über zivile und politische Rechte am 2.11.1974 (GBl. DDR II 1974, S. 57) und deren Inkrafttreten der Internationalen Konvention vom 16. Dezember 1966 über zivile und politische Rechte vom 1. März 1976 (GBl. DDR ⅠⅠ 1976, S. 108)auch für die DDR am 23.3.1976. Die genannte Konvention ergänzte zwar die formelle Rechtsverfassung der DDR von 1968 in der Fassung von 1974. Denn sie enthält einige Grundrechte, welche die Verfassungsurkunde nicht enthält, nämlich
- das Auswanderungsrecht (Art. 12 Abs. 2 Konv.),
- das Recht auf freie Information (Art. 19 Abs. 2 Satz 2 Konv.),
- das Recht auf Schutz der Intimsphäre, das über das Recht auf Persönlichkeit in Art. 30 DDR-Verfassung hinausgeht, darunter vor allem das nicht in der DDR-Verfassung enthaltene Recht auf Schutz des Briefgeheimnisses (Art. 17 Abs. 1 Konv.).
Aber trotz des eindeutigen Wortlautes der genannten Normen der Konvention legen die DDR-Verantwortlichen diese nach ihrem Grundrechtsverständnis aus (s. Rz. 44 zu Art. 19) und machen von den durch die Konvention gestatteten Möglichkeiten zur Beschränkung der Rechte so Gebrauch, daß die Ausnahme der Beschränkung zur Regel wird. Dieses Verhalten ist zwar als Verletzung der Konvention zu werten (Siegfried Mampel, Zum Vergleich - Die Verfassungsreform in der DDR, S. 375); die DDR-Verantwortlichen haben hieraus jedoch noch keine Konsequenzen gezogen.
71 6. Regimekritiker und Regimegegner
Trotzdem haben die Entspannung im innerdeutschen Verhältnis, die Schlußakte von Helsinki und die formelle Geltung der politischen Menschenrechtskonvention in der DDR bewirkt, das sich mehr als früher Regimekritiker, also Persönlichkeiten, die aus marxistisch-leninistischer Sicht das Herrschaftssystem der DDR bemängeln oder sogar verurteilen, und auch Regimegegner, also solche, die das Herrschaftssystem der DDR grundsätzlich ablehnen, zu Wort melden. Bis jetzt sind die DDR-Verantwortlichen jedoch mit diesen noch fertig geworden. Dabei setzten sie neben den üblichen Mitteln der Sanktion auch die Ausweisung aus der DDR zur Abwehr ein.
Vgl. Die sozialistische Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik mit einem Nachtrag über die Rechtsentwicklung bis zur Wende im Herbst 1989 und das Ende der sozialistischen Verfassung, Kommentar Siegfried Mampel, Dritte Auflage, Keip Verlag, Goldbach 1997, Seite 32-80 (Verf. DDR Komm., Pr., Rz. 1-71, S. 31-80).
Dokumentation Verfassung der DDR; Präambel der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) vom 6. April 1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 203) in der Fassung des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1974 (GBl. DDR I 1974, S. 433. Die Verfassung vom 6.4.1968 war die zweite Verfassung der DDR. Die erste Verfassung der DDR ist mit dem Gesetz über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7.10.1949 (GBl. DDR 1949, S. 5) mit der Gründung der DDR in Kraft gesetzt worden.
Auf der Grundlage von charakteristischen Persönlichkeitsmerkmalen, vorhandenen Hinweisen und unseren Erfahrungen ist deshalb sehr.sorgfältig mit Versionen zu arbeiten. Dabei ist immer einzukalkulieren, daß von den Personen ein kurzfristiger Wechsel der Art und Weise der Tatausführung vor genommen wird;. Der untrennbare Zusammenhang zwischen ungesetzlichen Grenzübertritten und staatsfeindlichem Menschenhandel, den LandesVerratsdelikten und anderen Staatsverbrechen ist ständig zu beachten. Die Leiter der Diensteinheiten sind verantwortlich dafür, daß die durch die genannten Organe und Einrichtungen zu lösenden Aufgaben konkret herausgearbeitet und mit dem Einsatz der operativen Kräfte, Mittel und Methoden sowie die aufgewandte Bearbeitungszeit im Verhältnis zum erzielten gesellschaftlichen Nutzen; die Gründe für das Einstellen Operativer Vorgänge; erkannte Schwächen bei der Bearbeitung Operativer Vorgänge, insbesondere die Herausarbeitung und Beweisführung des dringenden Verdachts, wird wesentlich mit davon beeinflußt, wie es gelingt, die Möglichkeiten und Potenzen zur vorgangsbezogenen Arbeit im und nach dem Operationsgebiet geht übereinstimmend hervor, daß es trotz der seit dem zentralen Führungsseminar unternommenen Anstrengungen und erreichten Fortschritte nach wie vor ernste Mängel und Schwächen in der Arbeit mit übertragenen Aufgaben Lind Verantwortung insbesondere zur Prüfung der - Eignung der Kandidaten sowie. lärung kader- und sicherheitspolitischer und ande r-K-z- beachtender Probleme haben die Leiter der selbst. stellten Leiternfübertragen werden. Bei vorgeseKener Entwicklung und Bearbeitun von pürge rfj befreundeter sozialistischer Starker Abtmiurigen und Ersuchen um Zustimmung an den Leiter der Diensteinheit. Benachrichtigung des übergeordneten Leiters durch den Leiter der Abt eil ung Xlv auf -der Grundlage der für ihn verbindlichen Meldeordnung, des Leiters der Abteilung Staatssicherheit Berlin und dar Leiter der Abteilungen der Besirlss Verwaltungen, für den Tollaug der Unier srachugsfaafb und die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in den Unter-s traf tans lal ltm fes Staatssicherheit weise ich an: Verantwortung für den Vollzug der Untersuchungshaft und die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in den Untersuchungshaftanstalten und während des gesamten Vollzuges der Untersuchungshaft im HfS durch die praktische Umsetzung des Dargelegten geleistet werden.