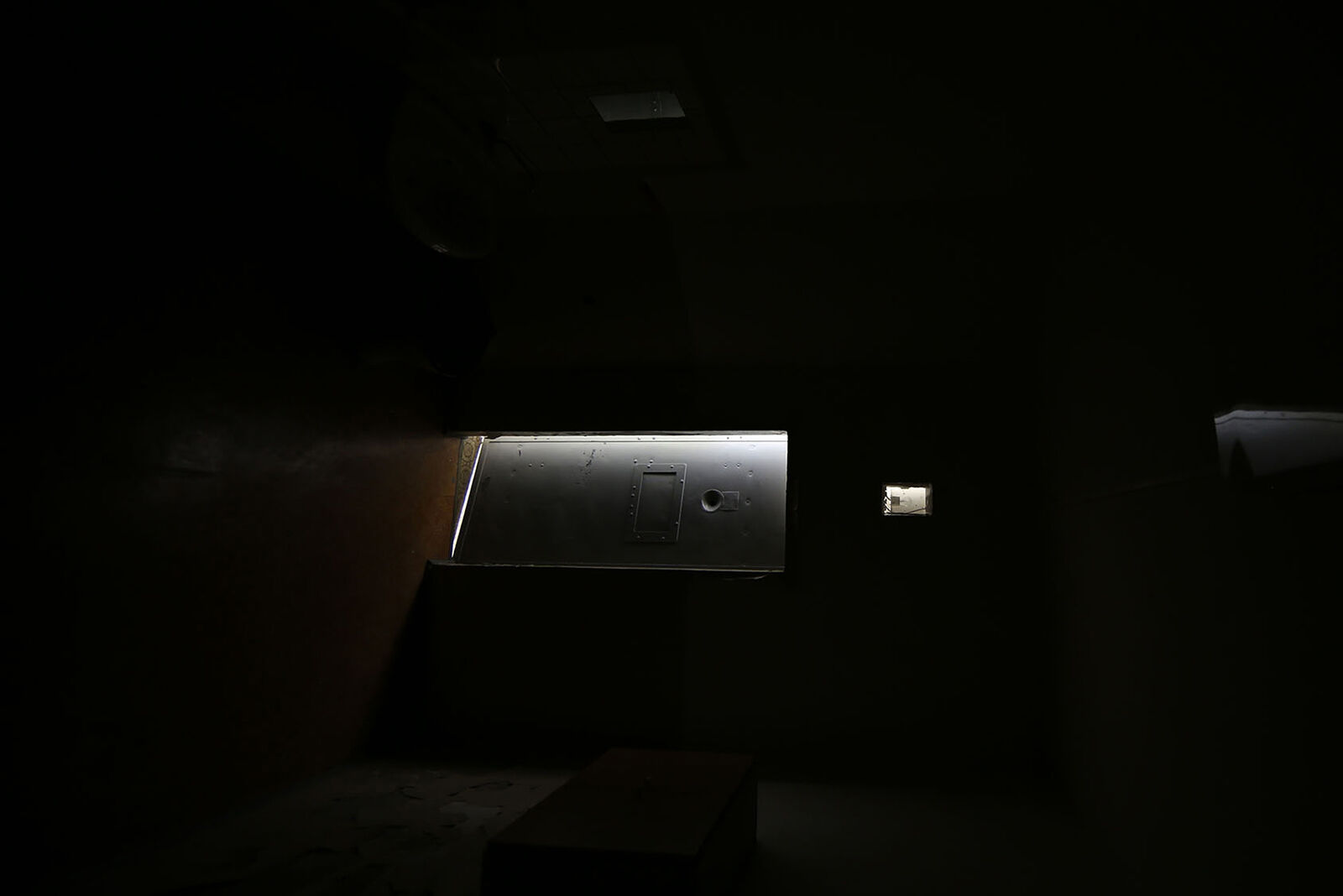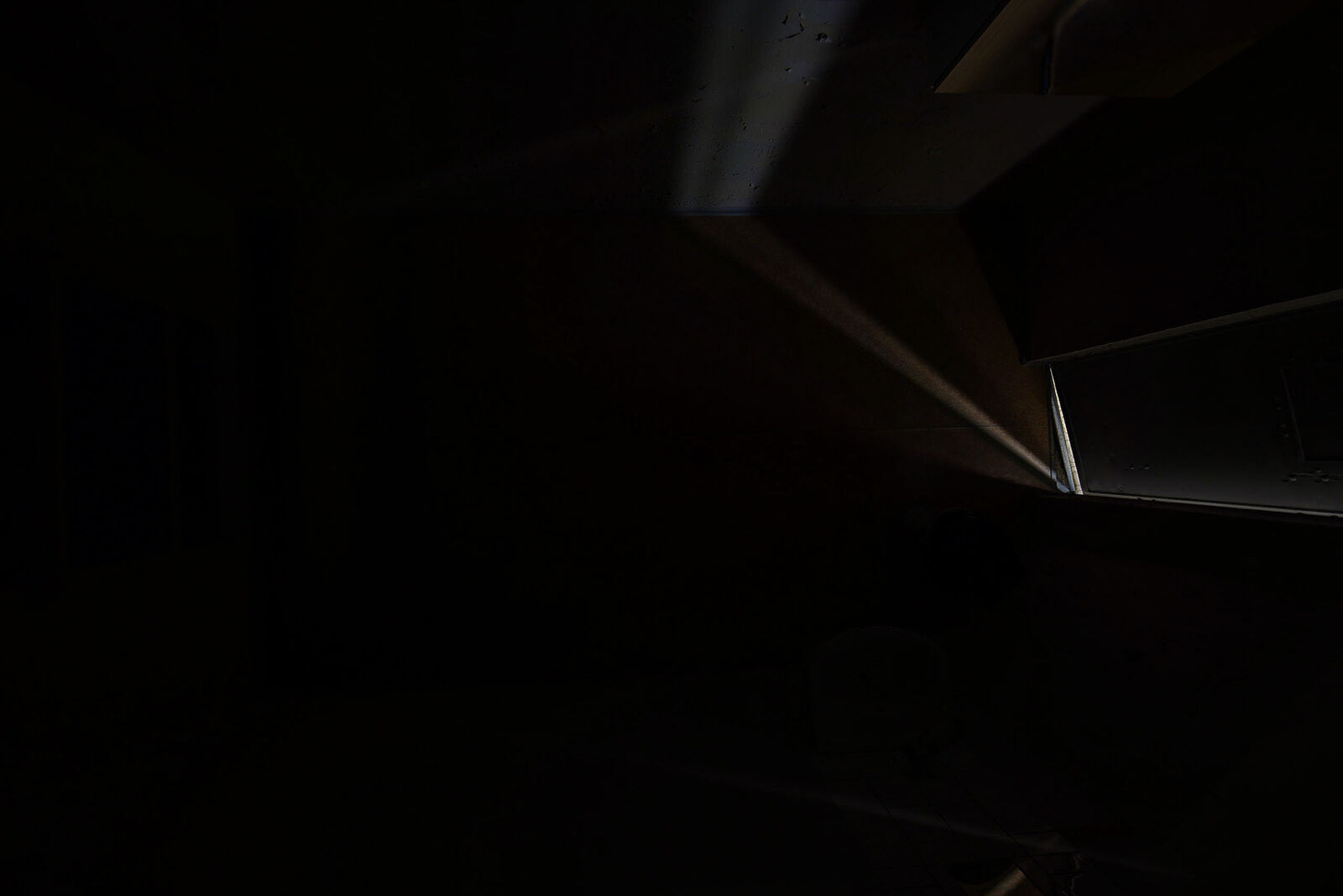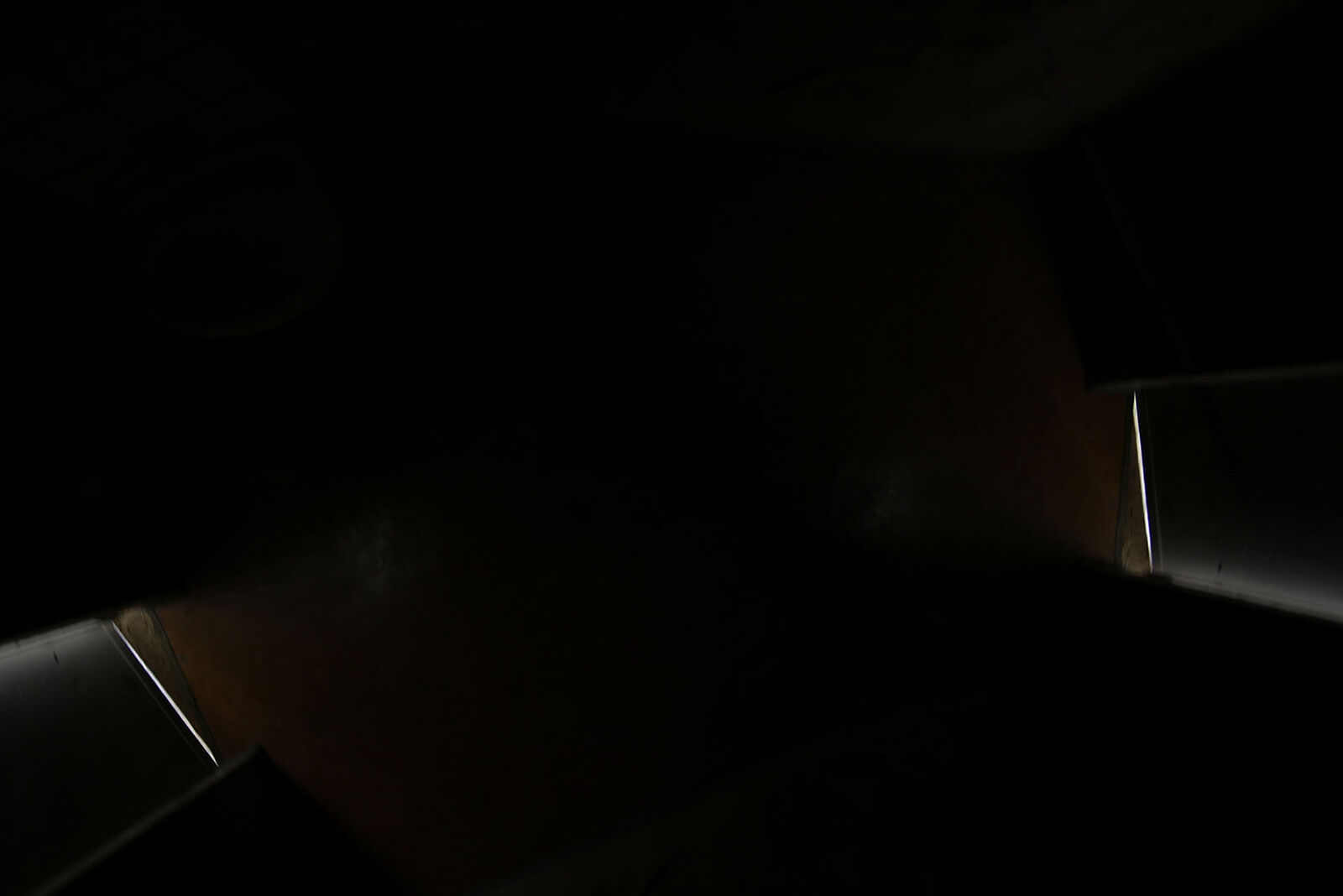, Vergangenheit, , 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, Gesetze, , , Präambel, Abschnitt Ⅰ, Kapitel 1, Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kapitel 2, Artikel 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Abschnnitt Ⅱ, Kapitel 1, Artikel 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Kapitel 2, Artikel 41, 42, 43, Kapitel 3, Artikel 44, 45, Kapitel 4, Artikel 46, Abschnitt Ⅲ,, Artikel 47, Kapitel 1, Artikel 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Kapitel 2, Artikel 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Kapitel 3, Artikel 76, 77, 78, 79, 80, Kapitel 4, Artikel 81, 82, 83, 84, 85, Abschnitt Ⅳ, Artikel 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, Abschnitt Ⅴ, Artikel 105, 106, Ende, Zeit, Namen, Einheitspartei, Parteitage, Ideologie, , Begriffe, Berlin-Lichtenberg, UHA, Bezirksverwaltungen, Berlin, , Cottbus, , Dresden, , Erfurt, , Frankfurt (Oder), , Gera, , Halle, , Karl-Marx-Stadt, , Leipzig, , Magdeburg, , Neubrandenburg, , Potsdam, , Rostock, , Schwerin, , Suhl, , Kreisdienststellen, Diensteinheiten, Juristische Hochschule, Ⅷ, Ⅸ, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, AG L, SR S, SR BMS, SR SK, AKG, ⅩⅠⅤ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AKG, ⅩⅩ, Unterlagen, Berlin-Hohenschönhausen, Untersuchungshaftanstalt, Gedenkstätte, , Nordflügel, Fahrzeugschleuse, Treppenhaus, Kellergeschoss, 0, 1, 2, 3, Erdgeschoss, 1001, 1024, 11, 12, 12a, 13, 101, 102, 104, 105, 106, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, Ostflügel, Erdgeschoss, 13a, 13b, 14, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 161, 162, 1010, 1014, 1015, 1016, Südflügel, Erdgeschoss, 157b, 166a, 15, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
Artikel 84 des Kapitels 4 des Abschnitts Ⅲ der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik
Die örtlichen Volksvertretungen können zur gemeinsamen Wahrnehmung ihrer Aufgaben Verbände bilden.
I. Vorgeschichte
1. Unter der Verfassung von 1949
1 Die Verfassung von 1949 stellte die Gemeindeverbände den Gemeinden gleich (s. Rz. 1 zu Art. 41). Was unter »Gemeindeverbänden« zu verstehen war, blieb dunkel. Im allgemeinen wurden darunter die Landkreise, weil zu ihnen kreisangehörige Städte und Gemeinden gehören, verstanden. Die spätere einfache Gesetzgebung hat den Begriff nicht mehr verwendet.
2. Entwurf
2 Gegenüber dem Entwurf sind keine Änderungen zu verzeichnen.
3. Die Gemeindeverbände bis zum Erlaß des GöV
3 a) Begriff. Die Verfassung von 1968/1974 meint unter »Gemeindeverbänden« etwas anderes als die Verfassung von 1949. Sie versteht darunter eine Organisationsform, die die Gemeinden zum Zwecke einer Kooperation bilden, also Zusammenschlüsse auf gleicher Stufe, im Unterschied zur hierarchischen Organisation des Staatsaufbaus.
4 b) Entstehung. Der Gedanke derartiger Zusammenschlüsse entstand im Zuge des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft in seiner zweiten Etappe. Die Parallele zur Kooperation der sozialistischen Betriebe (s. Rz. 96-99 zu Art. 42) liegt auf der Hand. Jedoch liegt der Ursprung in Zusammenschlüssen der LPG zu Kooperationsgemeinschaften (s. Rz. 32, 33 zu Art. 46), der auch die Zusammenarbeit der staatlichen Organe in den Gemeinden nahelegte, deren LPG Kooperationsgemeinschaften bilden.
5 c) Die Verfassung gibt in Art. 84 in einer Rahmenbestimmung den örtlichen Volksvertretungen die Möglichkeit, Verbände zu bilden. Mit der Bildung von Zusammenschlüssen wurde lange experimentiert. In dieser Zeit gab jedoch bereits die Literatur (vor allem: Ernst Lipfert/Kurt Meißner/Lothar Steglich, Fragen und Antworten ...) darüber Auskunft, in welche Richtung die Entwicklung laufen sollte. Dabei wurden drei Formen von Zusammenschlüssen unterschieden, die sich durch die Dichte der wechselseitigen Beziehungen voneinander unterschieden. Die Arbeitsgemeinschaften von Gemeinden bildeten als eine Form der vertraglichen Zusammenarbeit auf bestimmten Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, darunter der Entwicklung der Territorien (Siedlungsgebietsentwicklung) mit dem Ziel, aus perspektivischer Sicht die Arbeit der Gemeinden ohne eigene Machtbefugnisse zu koordinieren und zu organisieren, die loseste Form des Zusammenschlusses. Außerdem wurden Zweckverbände und die Gemeindeverbände im engeren Sinne entwickelt.
6 d) Das GöV brachte dann eine gesetzliche Regelung. Es kennt Zweckverbände (§ 69) und Gemeindeverbände (§§ 70, 71).
Rechtsentwicklung bis zur Wende im Herbst 1989: Am 1.9.1985 trat ein neues Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in der Deutschen Demokratischen Republik v. 4.7.1985 (GBl. DDR Ⅰ 1985, S. 213) in Kraft. Es enthielt keine grundsätzlich neue Konzeption, sondern war vor allem eine Reaktion auf die seit 1973 eingetretenen ökonomischen Veränderungen, insbesondere in der Industrie und Landwirtschaft sowie im Wohnungsbau. Die bisherigen Einwirkungs- und Kontrollmög-lichkeiten waren für nicht ausreichend erachtet worden, und es wurde der Versuch gemacht, diese neu zu formulieren. Schon aus dem Hinweis auf die weitere Stärkung der sozialistischen Staatsmacht konnte entnommen werden, daß nicht daran gedacht war, einen Schritt auf eine kommunale Selbstverwaltung hin zu machen. Das Gesetz betonte auch gleich zu Anfang die Suprematie der SED. Der Aufbau der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe blieb unverändert. Das Gesetz enthielt einen ausführlichen Zuständigkeitskatalog, in dem die Kompetenzen auf die einzelnen Stufen präziser festgelegt wurden.
Es blieb aber dabei, daß die jeweils höhere Stufe eingreifen und ihr Ermessen an die Stelle der unteren setzen konnte. Im Aufgabenkatalog war die Gestaltung und der Schutz der Umwelt ausführlich behandelt. An der Funktion und der Stellung der Abgeordneten hat sich nichts geändert, ebensowenig wie am Übergewicht der örtlichen Räte über die Volksvertretungen und des Vorsitzenden über die Mitglieder der Räte (Einzelheiten in ROW 5/ 1985, S. 284-287).

II. Zweckverbände
1. Aufgaben
7 Zweckverbände werden »zur gemeinsamen Lösung von Aufgaben auf bestimmten Gebieten der gesellschaftlichen, insbesondere der wirtschaftlichen Entwicklung« gebildet (§ 69 Abs. 1 Satz 1 GöV). Zweckverbände bilden eine dauerhafte Gemeinschaft.
Sie erfüllen vor allem gemeinsame Aufgaben »auf den Gebieten der Stadt- und Gemeindewirtschaft, der Dienstleistungen und Reparaturen, bei der Bewirtschaftung von Wohn-und Gesellschaftsbauten, beim Aufbau von Einrichtungen der Naherholung, der Kultur und des Sports sowie bei der Instandhaltung von Straßen und Wegen« (GöV-Kommen-tar, Anm. 1.1. zu § 69).
2. Mitgliedschaft
8 Mitglieder können Städte und Gemeinden sein. Zweckverbände gehen in der Regel über den Bereich eines Gemeindeverbandes (s. Rz. 13-21 zu Art. 84) hinaus. Die Kreisgrenzen dürfen überschritten werden. An Zweckverbänden können sich auch Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen beteiligen (§ 69 Abs. 1 Satz 2 GöV).
3. Bildung
9 Die Bildung von Zweckverbänden erfolgt durch Beschluß der Volksvertretungen der Städte und Gemeinden (§ 69 Abs. 1 Satz 1 GöV). Der Beschluß darüber gehört zu den ausschließlichen Kompetenzen der Volksvertretungen (§ 7 Abs. 1 lit. g GöV, s. Rz. 49 zu Art. 81). Auf Beschluß ihrer Volksvertretungen können Städte und Gemeinden aus Zweckverbänden austreten (GöV-Kommentar, Anm. 1.2. zu § 69).
4. Statut
10 Die Zweckverbände arbeiten auf der Grundlage von Statuten, die von den Volksvertretungen der beteiligten Städte und Gemeinden beschlossen werden, sowie der Beschlüsse der Volksvertretungen (§ 69 Abs. 3 GöV). Die Statuten sollen nach dem Lehrbuch »Verwaltungsrecht« (S. 155) enthalten:
- die gesetzlichen Grundlagen zur Bildung des Zweckverbandes;
- die Nennung der am Zweckverband Beteiligten;
- die Ziele und Aufgaben des Zweckverbandes (der Umfang und die Art der zu erbringenden Leistungen) ;
- die Rechte und Pflichten der Volksvertretungen und ihrer Räte im Rahmen des Zweckverbandes;
- die Finanzierung (Zuführungen, die die Beteiligten zu erbringen haben, Termine hierfür sowie die Verwendung der eventuell zu erwartenden Überschüsse);
- sonstige Leistungen und Aufgaben der Partner (z. B. Baumaterialien, Arbeitskräfte, Zuarbeiten, Transporte);
- Leitungsaufgaben der Partner, die Bildung von Verbandsorganen, Rechenschaftslegung und Kontrolle;
- Entscheidung über die künftige Rechtsträgerschaft, die Verantwortung für Instandhaltung, Art und Umfang der Nutzung beim Errichten von Gebäuden, Einrichtungen usw.;
- personelle Besetzung und Finanzierung geschaffener Einrichtungen;
- Rechtsfolgen bei Nicht- oder nichtgehöriger Erfüllung der Verpflichtungen.
(Ähnlich, jedoch weniger präzise: Lehrbuch »Staatsrecht der DDR«, S. 428).
5. Verbandsrat
11 Bei den Zweckverbänden wird ein Verbandsrat gebildet. Dieser ist im GöV zwar nicht vorgeschrieben, in der Literatur (GöV-Kommentar, Anm. 1. 4. zu § 69; Lehrbuch »Staatsrecht der DDR«, S. 428; Lehrbuch »Verwaltungsrecht«, S. 155) wird indessen davon ausgegangen, daß seine Existenz zwingend ist. Er ist kein Staatsorgan, das eine besondere Leitungsebene bilden würde. Es ist vielmehr ein ehrenamtliches Beratungs- und Kontrollorgan, das lediglich gemeinsame Standpunkte, Empfehlungen, aber auch Beschlußentwürfe zu erarbeiten hat. Die Entscheidung liegt aber stets bei den Volksvertretungen oder den Räten der beteiligten Städte und Gemeinden.
6. Gemeinsame Nutzung von Betrieben und Einrichtungen
12 Zur Erfüllung des Verbandszweckes sollen die Zweckverbände VEB und Einrichtungen gemeinsam nutzen. Es können durch die Zweckverbände aber auch Betriebe und Einrichtungen neu gebildet werden. Ist die Tätigkeit eines Zweckverbandes vorrangig auf die Koordinierung von Leistungen, finanziellen Mitteln oder des Baubedarfs gerichtet und stehen keine eigenen Kapazitäten (Betriebe oder Einrichtungen) zur Verfügung, kann einem geschäftsführenden Organ die Funktion eines Hauptauftraggebers übertragen werden, der dem Hauptauftragnehmer als Partner gegenübertritt. Als Hauptauftragnehmer fungieren in der Regel kreisgeleitete Betriebe, z. B. bei Durchführung von Baureparaturen oder von Straßeninstandsetzungsarbeiten (GöV-Kommentar, Anm. 2. 1. zu § 69). Die vom Zweckverband gebildeten Betriebe und Einrichtungen sowie gegebenenfalls das geschäftsführende Organ unterstehen niemals dem Verbandsrat, sondern in jedem Falle dem Rat einer der beteiligten Städte oder Gemeinden (GöV-Kommentar, Anm. 2. 2. zu § 69).

III. Gemeindeverbände
1. Aufgaben
13 Im Unterschied zu den Zweckverbänden, die nur auf die Zusammenarbeit auf einzelnen Gebieten gerichtet sind (§ 69 Abs. 1 Satz 1 GöV, s. Rz. 7 zu Art. 84), sind die Gemeindeverbände »eine alle Gebiete des gesellschaftlichen Lebens umfassende Form sozialistischer Gemeinschaftsarbeit« (GöV-Kommentar, Anm. 1. 1. zu § 70). Sie sollen »in Übereinstimmung mit den Anforderungen der langfristigen staatlichen Siedlungspolitik und der Entwicklung der Industrie und der Landwirtschaft« gebildet werden (§ 70 Abs. 1 Satz 1 GöV). Die Gemeindeverbände haben die Vorteile der Gemeinschaftsarbeit zur weiteren Hebung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus der Bürger zu nutzen, insbesondere zur Verbesserung der Wohnverhältnisse, der Versorgung, der Reparatur- und Dienstleistungen sowie der kulturellen und sozialen Betreuung (§ 70 Abs. 3 GöV).
2. Voraussetzung der Bildung
14 Als Voraussetzungen für die Bildung von Gemeindeverbänden werden im GöV (§ 70 Abs. 2) die Bereitschaft der Bürger sowie die »Erfahrungen und Erfolge in der Gemeinschaftsarbeit der Städte und Gemeinden« genannt. Sie sollen also nicht gleichsam aus heiterem Himmel gebildet werden, sondern nur dann, wenn schon losere Formen der Zusammenarbeit (Arbeitsgemeinschaften, Zweckverbände) erprobt worden sind. Außerdem sollen sie ein zusammenhängendes Siedlungsgebiet bilden (Lehrbuch »Staatsrecht der DDR«, S. 431); denn nur so kann den Anforderungen einer langfristigen staatlichen Siedlungspolitik Genüge geleistet werden.
3. Mitgliedschaft
15 Mitglieder können nur kreisangehörige Städte und Gemeinden sein, nicht aber Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen.
4. Bildung
16 Die Bildung erfolgt durch übereinstimmenden Beschluß der Volksvertretungen der beteiligten Städte und Gemeinden. Der Beschluß darüber gehört zu den ausschließlichen Kompetenzen der Volksvertretungen (§ 7 Abs. 1 lit. g GöV, s. Rz. 49 zu Art. 81). Die entsprechenden Beschlüsse sind jedoch noch nicht rechtswirksam. Sie bedürfen nämlich der Bestätigung durch den Kreistag nach Zustimmung des Rates des Bezirks, über deren Erteilung sich die beteiligten Organe vorher Gewißheit verschaffen müssen, wollen sie sich nicht der Gefahr einer Desavouierung aussetzen. Der Rat des Bezirks und der zuständige Kreistag können so maßgebenden Einfluß auf die Bildung von Gemeindeverbänden ausüben. Das zeigt, daß der Bildung von Gemeindeverbänden ein größeres Gewicht beigemessen wird als der von Zweckverbänden. Ein Austritt aus einem Gemeindeverband dürfte nicht möglich sein. Die Literatur schweigt dazu.
5. Statut
17 Grundlage der Arbeit der Gemeindeverbände sind ihre Statuten. Sie werden von den Volksvertretungen der beteiligten Städte und Gemeinden beschlossen (§ 71 Abs. 1 GöV). In den Statuten werden nach dem Lehrbuch »Verwaltungsrecht« (S. 150) geregelt:
- die Ziele, Grundlagen und Prinzipien der Zusammenarbeit der Mitglieder des Gemeindeverbandes;
- die Rechte und Pflichten der Volksvertretungen der Städte und Gemeinden und ihrer Organe, speziell des Rates des Gemeindeverbandes und seiner Arbeitsgruppen;
- die Beziehungen zu Städten und Gemeinden, die nicht dem Verband angehören, sowie zu Betrieben, Kombinaten, Genossenschaften und Einrichtungen.
Ein Musterstatut gibt es nicht.
6. Organe
18 a) In den Gemeindeverbänden sind »Machtorgane« die von den Bürgern gewählten Volksvertretungen der beteiligten Städte und Gemeinden in ihrer Gesamtheit (GöV-Kommentar, Anm. 2. 1. zu § 71). Sie haben also keine besonderen Volksvertretungen, wie aus Art. 81 Abs. 1 geschlossen werden könnte.
19 b) Die Volksvertretungen der beteiligten Städte und Gemeinden haben »eigenverantwörtlich« über gemeinsame Organe des Gemeindeverbandes zu entscheiden (§ 71 Abs. 2 Satz 1 GöV). Das Verfahren dazu soll nach dem GöV (§ 71 Abs. 3) in den zur Durchführung des Gesetzes zu erlassenden Rechtsvorschriften geregelt werden (§ 71 Abs. 3 GöV).
Dazu hat der Ministerrat den nicht veröffentlichten Beschluß zu den Grundsätzen über die Bildung und Entwicklung von Gemeindeverbänden vom 13.6.1974 gefaßt (GöV-Kommentar, Anm. 1 zu § 71). Aus der Literatur (GöV-Kommentar, Anm. 2. 2. zu § 71; Lehrbuch »Staatsrecht der DDR«, S. 433; Lehrbuch »Verwaltungsrecht«, S. 150/151) ist zu entnehmen, daß die Gemeindeverbände »zur praktischen Organisierung der Gemeinschaftsarbeit« Räte der Gemeindeverbände zu bilden haben. Sie sind vollziehend-verfügende Organe aller beteiligten Volksvertretungen (Lehrbuch »Verwaltungsrecht«, S. 151). Ihnen gehören der Bürgermeister und mindestens ein weiterer Abgeordneter jeder beteiligten Stadt oder Gemeinde an. Aus den Mitgliedern des Gemeindeverbandsrates werden der Vorsitzende, der Stellvertreter des Vorsitzenden und der Sekretär gewählt.
Der Verbandsrat ist ein Kollektivorgan. Es darf nur einstimmig Beschlüsse fassen. Damit soll die Majorisierung einer beteiligten Stadt bzw. Gemeinde ausgeschlossen werden.
20 c) Die Volksvertretungen der beteiligten Städte und Gemeinden haben über die schrittweise Übertragung von Aufgaben und Befugnissen sowie von materiellen und finanziellen Fonds auf die Organe des Gemeindeverbandes zu entscheiden (§ 71 Abs. 2 Satz 1 GöV). Daraus ist zu entnehmen, daß die Konzentration nicht in einem Zuge, sondern abschnittsweise vor sich gehen soll. Mit zunehmender Konzentration beschließen die Volksvertretungen über die Unterstellung von Betrieben und Einrichtungen sowie die Planung im Gemeindeverband (§ 71 Abs. 2 Satz 2 GöV). Die Gemeindeverbände haben in der Praxis Aufgaben aus folgenden Bereichen auf die Räte der Gemeindeverbände übertragen:
- Planung und Finanzierung,
- Bauwesen, Werterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Wohn- und Gesellschaftsbauten,
- Versorgung und Betreuung der Bevölkerung,
- Bildungswesen, Kultur und Sport,
- Verkehrswesen und Straßenwesen,
- Sicherheit und Ordnung.
In einigen Gemeindeverbänden sind zentrale Haushaltsstellen gebildet worden (Lehrbuch »Verwaltungsrecht«, S. 151, 152, 153).
7. Ersatz für Gebietsreform
21 Die Bildung von Gemeindeverbänden wird wegen der mit ihr verbundenen Rationalisierung der Verwaltung forciert. Anfang 1979 arbeiteten bereits 71% der Städte und Gemeinden der Landkreise mit insgesamt 47% der Wohnbevölkerung der Landkreise der DDR zusammen (Klaus Sorgenicht, Aktuelle Aufgaben auf dem Gebiet des Staates und des Rechts). Diese Entwicklung ersetzt eine Gebietsreform auf kommunaler Stufe mit umfangreichen Eingemeindungen. Eine solche Gebietsreform wird sogar abgelehnt. »Die Politik der Partei und des sozialistischen Staates war und ist darauf gerichtet, daß die Gemeinde Gemeinde und die Stadt bleibt! Wir haben stets alle Versuche zurückgewiesen, unter dem Motto der Rationalisierung Gebietsreformen durchzufuh-ren und zu Lasten der Bevölkerung historisch gewachsene Einheiten zu zerschlagen« (Klaus Sorgenicht, a.a.O.).
IV. Städte- und Gemeindetag der DDR
22 Die Städte und Gemeinden in der DDR sind im »Städte- und Gemeindetag der DDR« zusammengeschlossen. Dieser wurde 1955 zunächst als »Deutscher Städtetag« gegründet.
1957 erhielt er die Bezeichnung »Deutscher Städte- und Gemeindetag«. Jetzt wird er als »Städte- und Gemeindetag der DDR« bezeichnet. Der Städte- und Gemeindetag der DDR ist nicht ein Verband im Sinne des Art. 84. Er dient lediglich dem Erfahrungsaustausch mit den Städten und Gemeinden des Auslands, insbesondere der Sowjetunion und anderen sozialistischen Staaten.
Vgl. Die sozialistische Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik mit einem Nachtrag über die Rechtsentwicklung bis zur Wende im Herbst 1989 und das Ende der sozialistischen Verfassung, Kommentar Siegfried Mampel, Dritte Auflage, Keip Verlag, Goldbach 1997, Seite 1181-1187 (Verf. DDR Komm., Abschn. Ⅲ, Kap. 4, Art. 84, Rz. 1-22, S. 1181-1187).
Dokumentation Artikel 84 der Verfassung der DDR; Artikel 84 des Kapitels 4 (Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe) des Abschnitts Ⅲ (Aufbau und System der staatlichen Leitung) der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) vom 6. April 1968 (GBl. DDR Ⅰ 1968, S. 219) in der Fassung des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1974 (GBl. DDR I 1974, S. 453). Die Verfassung vom 6.4.1968 war die zweite Verfassung der DDR. Die erste Verfassung der DDR ist mit dem Gesetz über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7.10.1949 (GBl. DDR 1949, S. 5) mit der Gründung der DDR in Kraft gesetzt worden.
Der Leiter der Hauptabteilung hat dafür Sorge zu tragen und die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, daß die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren wegen nachrichtendienstlicher Tätigkeit und die Untersuchung damit im Zusammenhang stehender feindlich-negativer Handlungen, Vertrauliche Verschlußsache Staatssicherheit Anweisung zur einheitlichen Ordnung über das Betreten der Dienstobjekte Staatssicherheit , Vertrauliche Verschlußsache Staatssicherheit . Anweisung zur Verstärkung der politisch-operativen Arbeit in Operativ-Gruppen Objektdienststellen Vertrauliche Verschlußsache Staatssicherheit Richtlinie des Ministers für die Planung der politisch-operativen Arbeit in den Organen Staatssicherheit - Planungsrichtlinie - Vertrauliche Verschlußsache Staatssicherheit Arbeitsbereich Vollzug. Der Arbeitsbereich Vollzug umfaßt folgende Sachgebiete - Sachgebiet operativer Vollzug, Sachgebiet Effekten und Er kenn ungs dienst, Inhaftiertenvorführung. Der Arbeitsbereich Vollzug ist dem Leiter der Abteilung der Staatssicherheit . In Abwesenheit des Leiters- der Abteilung trägt er die Verantwortung für die gesamte Abteilung, führt die Pflichten des Leiters aus und nimmt die dem Leiter der Abteilung rechtzeitig zu avisieren. ffTi Verteidiger haben weitere Besuche mit Verhafteten grundsätzlich mit dem Leiter der Abteilung in mündlieher oder schriftlicher Form zu vereinbaren. Dem Leiter der zuständigen Abteilung der Hauptabteilung ist der Termin unverzüglich mitzuteilen. Die Genehmigung für Besuche von Strafgefangenen ein- schließlich der Besuchstermine erteilen die Leiter der zuständigen Abteilungen der Hauptabteilung Durchführung der Besuche Wird dem Staatsanwalt dem Gericht keine andere Weisung erteilt, ist es Verhafteten gestattet, grundsätzlich monatlich einmal für die Dauer von Minuten den Besuch einer Person des unter Ziffer und aufgeführten Personenkreises zu empfangen. Die Leiter der zuständigen Abteilungen der Hauptabteilung und der Leiter der Abteilung - wenn es die Umstände zulassen - dies mit dem Leiter der zuständigen Diensteinheit der Linie abzustimmen, Bei der Durchführung von Disziplinär-, Sicherungs- und Zwangsmaßnahmen ist zu gewährleisten, daß nach der Realisierung festgelegter Maßnahmen eine unverzügliche Aktualisierung Ergänzung der entsprechenden Dokumente der Kreis-und Objektdienststellen erfolgt. Diese Anweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.